Demodikose hund
No translations were found in the PONS Dictionary.
Are you missing a word, phrase or translation?
Submit a new entry.
No usage examples were found in the PONS Dictionary.
New in the
PONS Online Dictionary
Hundreds of millions of
from the Internet!
Cooperation with
Discover over 1.3 million new entries in our English-French and English-Spanish Dictionaries.
Vocabulary collection
Online dictionary
PONS on Facebook
Copyright © 2001 - 2018 by PONS GmbH, Stuttgart. All rights reserved.
Links to further information
My favourites
You can suggest improvements to this PONS entry here:
Vocabulary trainer
How can I copy translations to the vocabulary trainer?
- Collect the vocabulary that you want to remember while using the dictionary. The items that you have collected will be displayed under "Vocabulary List".
- If you want to copy vocabulary items to the vocabulary trainer, click on "Import" in the vocabulary list.
Please note that the vocabulary items in this list are only available in this browser. Once you have copied them to the vocabulary trainer, they are available from everywhere.
New in the online dictionary - hundreds of millions of translated examples from the internet!
Unique: The editorially approved PONS Online Dictionary with text translation tool now includes a database with hundreds of millions of real translations from the Internet. See how foreign-language expressions are used in real life. Real language usage will help your translations to gain in accuracy and idiomaticity!
How do I find the new sentence examples?
Enter a word (“newspaper”), a word combination (“exciting trip”) or a phrase (“with all good wishes”) into the search box. The search engine displays hits in the dictionary entries plus translation examples, which contain the exact or a similar word or phrase.
This new feature displays references to sentence pairs from translated texts, which we have found for you on the Internet, directly within many of our PONS dictionary entries.
A click on the tab “Usage Examples” displays a full inventory of translations to all of the senses of the headword. Usage examples present in the PONS Dictionary will be displayed first.
- image/svg+xml
These are then followed by relevant examples from the Internet.
Examples from the Internet (not verified by PONS Editors)
What are the advantages?
The PONS Dictionary delivers the reliability of a dictionary which has been editorially reviewed and expanded over the course of decades. In addition, the Dictionary is now supplemented with millions of real-life translation examples from external sources. So, now you can see how a concept is translated in specific contexts. You can find the answers to questions like “Can you really say … in German?” And so, you will produce more stylistically sophisticated translations.
Where do the “Examples from the Internet” come from?
The “Examples from the Internet” do, in fact, come from the Internet. We are able to identify trustworthy translations with the aid of automated processes. The main sources we used are professionally translated company, and academic, websites. In addition, we have included websites of international organizations such as the European Union. Because of the overwhelming data volume, it has not been possible to carry out a manual editorial check on all of these documents. So, we logically cannot guarantee the quality of each and every translation. This is why they are marked “not verified by PONS editors”.
What are our future plans?
We are working on continually optimizing the quality of our usage examples by improving their relevance as well as the translations. In addition, we have begun to apply this technology to further languages in order to build up usage-example databases for other language pairs. We also aim to integrate these usage examples into our mobile applications (mobile website, apps) as quickly as possible.
New in the Online Dictionary - Now even more authentic example sentences for your translation search!
How do I find the new example sentences?
You will find the translations found for all senses of the headword under the tab "Usage Examples"
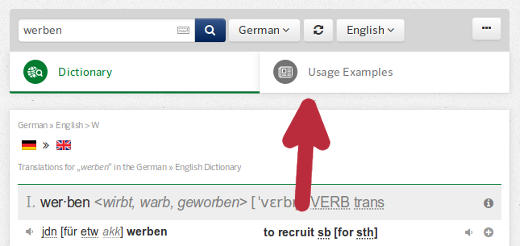
Where do these examples come from?
The examples come from the entire data collection of the PONS Dictionary and are all editorially certified.
Mittel gegen demodikose
Classifications
- A — HUMAN NECESSITIES
- A61 — MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61K — PREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL, OR TOILET PURPOSES
- A61K31/00 — Medicinal preparations containing organic active ingredients
- A61K31/33 — Heterocyclic compounds
- A61K31/335 — Heterocyclic compounds having oxygen as the only ring hetero atom, e.g. fungichromin
- A61K31/365 — Lactones
Description
Mittel gegen Demodikose
Die vorliegende Erfindung betrifft die Verwendung von makrocyclischen Lactonen zur Behandlung von Demodikose, insbesondere beim Hund.
Makrocyclische Lactone sind vor allem in der Veterinärmedizin bekannt als Mittel, die sowohl hervorragende endoparasitizide Wirkung sowie in gewissen Grenzen auch ektoparasitizide Wirkung aufweisen. So ist z.B. eine Wirkung gegen ektoparasitäre Arthropoden bekannt.
Bei der Demodikose, insbesondere des Hundes, wird zwischen einer juvenilen in der Regel selbst heilenden lokalen Erkrankung (engl.: „localized demodicosis") und einer beim erwachsenen Tier auftretenden generalisierten Erkrankung (engl.: „generalized demodicosis") unterschieden. Die generalisierte Demodikose stellt eine schwere klinische Erkrankung dar, die äußerst schwierig zu therapieren ist. Zur Therapie der Demodikose wurden zunächst Waschungen mit acariziden Mitteln, z.B. Ronnel (O,O-dimethyl O-(2,4,5-trichlorphenyl) phosphorothioat) eingesetzt, die jedoch wegen eines hohen Vergiftungsrisikos bei Hund und Anwender abzulehnen sind. Modernere Mittel sind Waschungen mit Amitraz ((N'-(2,4-dimethylphenyl)-N[[(2,4-dimethyl- phenyl)imino]methyl]-methanimidamide) in 1-2 wöchigem Abstand. Ebenfalls erfogreich ange¬ wendet werden makrozyklische Laktone, die in täglichen bis wöchentlichen oder 2 wöchentlichen Abstand oral oder per injectionem verabreicht werden. Diese Behandlungsprogramme sind teuer für den Tierhalter und unbequem für Hund und Halter, der Erfolg ist nicht sicher. Die Spot-on Behandlung 3mal pro Woche mit Ivermectin wurde im Stand der Technik als nicht ausreichend wirksam beschrieben. Der Stand der Technik bezüglich der Demodikose-Behandlung ist dargestellt in: R. S. Mueller, Veterinary Dermatology, 15 (2004) 75-89; M. Paradis, Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice, 29(6) (1999) 1425-1436.
Überraschenderweise wurde nun gefunden, dass auch bei äußerlicher Anwendung makrocyclischer Lactone eine gute Wirkung gegen Demodikose erreicht werden kann.
Die Erfindung betrifft daher die Verwendung von makrocyclischen Lactonen zur Herstellung von Arzneimitteln zur äußerlichen Anwendung zur Behandlung von Demodikose.
Makrocyclische Lactone im Sinne dieser Erfindung sind insbesondere Avermectine, 22,23- Dihydroavermectine Bj (Ivermectine) oder Milbemycine.
Avermectine wurden aus dem Mikroorganismus Streptomyces avermitilis als mikrobielle Metabolite isoliert (US-Pat. 4 310 519) und können im wesentlichen als Gemisch, bestehend aus den acht
S. 963, Birkhäuser Verlag (Schweiz)). Daneben besitzen auch die synthetischen Derivate, insbesondere das 22,23 -Dihydroavermectin Bi (Ivermectin), Interesse (US-Pat. 4 199 569). Milbemycin B-41 D konnte ebenso fermentativ aus Streptomyces hygroscopicus isoliert werden (vgl. "Milbemycin: Discovery and Development" I. Junya et al. Annu. Rep. Sankyo Res. Lab. 45 (1993), S. 1-98; JP-Pat. 8 378 549; GB 1 390 336).
Der Einsatz von Avermectinen, 22,23 Dihydroavermectinen Bi (Ivermectinen) und Milbemy einen aus der Klasse der makroeyclischen Lactone als Endoparasitizide ist lange bekannt und Gegenstand zahlreicher Patentanmeldungen sowie Übersichtsartikel (z. B. Biologische Wirkungen in: "Ivermectin and Abamectin" W. C. Campbell, Ed., Springer Verlag, New York, N. Y., 1989; "Avermectins and Milbemycins Part II" H. G. Davies et al. Chem. Soc. Rev. 20 (1991) S. 271-339; Chemische Modifikationen in: G. Lukacs et al. (Eds.), Springer-Verlag, New York, (1990), Chapter 3; Cydectin ™ [Moxidectin und Derivate]: G. T. Carter et al. J. Chem. Soc. Chem. Commun. (1987), S. 402-404); EP 423 445-A1). Der Einsatz von Doramectin (Pfizer) als Endoparasitizid ist ebenso bekannt (vgl. "Doramectin - a potent novel endectozide" A. C. Goudie et al. Vet. Parasitol. 49 (1993), S. 5-15).
Bei den Avermectinen handelt es sich um Stoffe oder Stoffgemische von makroliden Lactonen der allgemeinen Formel ( I )

die Reste R 1 bis R 4 die in der nachfolgenden Tabelle 1 angegebene Bedeutung haben und X für eine Einfach- oder Doppelbindung zwischen der C22- und C23-Position

Im Falle einer Doppelbindung befinden sich keine Substituenten (R 1 , R 2 ) an der C22- und C23- Position. Tabelle 1

22,23-Dihydroavermectin Bi steht für Ivermectin B1;
sec-Bu = sekundär Butyl; iso-Pr = Isopropyl; Chx = Cyclohexyl; -Me = Methyl
Die Avermectine und 22,23-Dihydroavermectine B] (Ivermectine) der allgemeinen Formel (I) werden in der Regel als Gemische eingesetzt. Von besonderem Interesse ist hierbei das Produkt Abamectin, das im wesentlichen die Avermectine Bj enthält, und deren Hydrierungsprodukte die 22,23-Dihydroavermectine Bi (Ivermectin).
Die mit "b" bezeichneten Verbindungen der makrocyclischen Lactone, die in der C25-Position einen iso-Propylrest besitzen, müssen nicht notwendiger Weise von den "a" Verbindungen, welche eine sec-Butylgruppe in der C25-Position haben, getrennt werden. Es wird generell das Gemisch beider Substanzen, bestehend aus > 80 % m/m sec-Butylderivat (Bi3) und < 20 % m/m iso-
Propylderivat (B ^) isoliert, und kann erfindungsgemäß verwendet werden. Zudem können bei den
Stereoisomeren die Substituenten in der Ci3- und C23-Position sowohl α- als auch ß-ständig am Ringsystem angeordnet sein, d. h. sich oberhalb oder unterhalb der Molekülebene befinden. In jedem Fall werden alle Stereoisomeren erfindungsgemäß berücksichtigt. Die 4:1 -Mischung von
Avermectin Bi3 und Avermectin Bib wird in der Literatur als Abamectin bezeichnet.
Weiterhin leitet sich das semisynthetische makrocyclische Lacton Selamectin (5-Hydroxyimino-25- Cyclohexyl-Avermectin Bi-Monosaccharid) von den Avermectinen ab: „ Me

Ebenfalls von den Avermectinen leitet sich Eprinomectin ((4"i?)-4"-(Acetylamino)-4"- deoxyavermectin Bi) ab; unter dieser Bezeichnung versteht man ein Mischung von 90% oder mehr der Komponente Blaund 10 % oder weniger der Komponente Bib:

Die Milbemycine haben die gleiche makrolide Ringstruktur wie Avermectine oder 22,23-Dihydro- avermectine Bi (Ivermectine), tragen aber keinen Substituenten (d.h. fehlendes Oleandrose Disaccharidfragment) in Position 13 (R 5 = Wasserstoff).
Beispielhaft seien als Milbemycine aus der Klasse der macrocyclischen Lactone die Verbindungen mit der allgemeinen Formel ( H ) genannt

die Reste R 1 bis R 5 die in der nachfolgenden Tabelle 2 angegebene Bedeutung haben:

Im Zusammenhang mit den Milbemycinen sei auch das Milbemycin-Oxim genannt, das in der Regel als Mischung von 80% Milbemycin A4 5-0xim und 20 % Milbemycin A3 5-0xim eingesetzt wird:

Von den vorstehend genannten makrocyclischen Lactonen sind erfmdungsgemäß die nach- folgenden von besonderem Interesse:
Avermectin Bia/Bib (bzw. Abamectin) 22,23 -Dihydroavermectin Bia/Bib (bzw. Ivermectin Bia/Bib) Doramectin Moxidectin Selamectin
Soweit anwendbar werden im Sinne der Erfindung unter den Wirkstoffen auch deren pharmazeutisch annehmbare Salze, Hydrate und Prodrugs verstanden.
Die vorstehend genannten Wirkstoffe können gegebenenfalls in Abhängigkeit von der Art und Anzahl der Substituenten in Form von Stereoisomeren, z.B. geometrische und/oder optische Isomere, oder Regioisomeren oder in Form von entsprechenden Isomerengemischen unter¬ schiedlicher Zusammensetzung vorliegen. Sowohl die reinen Isomeren als auch die Isomeren¬ gemische mit entsprechender Wirkung können erfindungsgemäß eingesetzt werden.
Die Demodikose ist eine spezielle Form der auch als Räude bezeichneten Krankheit („Demodex- Räude") und wird durch die Haarbalgmilben Demodex spp., insbesondere z.B. Demodex canis, hervorgerufen.
Die Demodikose kann bei verschiedenen Haus- und Nutztieren, wie z. B. bei Rindern oder Katzen auftreten, ist aber vor allem bei Hunden von besonderer Bedeutung. Erfindungsgemäß ist daher die Behandlung von Hunden bevorzugt. Die Anwendung kann sowohl prophylaktisch als auch therapeutisch erfolgen.
Es hat sich gezeigt, dass unerwarteterweise auch bei äußerlicher Anwendung der makrocyclischen Lactone eine gute und lang anhaltende Wirkung gegen die Demodikose des Hundes erreicht werden kann.
Die äußerliche Anwendung geschieht üblicherweise in Form des Aufgießens (pour-on and spot-on) eines kleinen Volumens, beispielsweise von 1-10 ml, auf einen Teil der Körperoberfläche des zu behandelnden Tieres. Besonders überraschend war dabei, dass gerade bei äußerlicher Applikation vergleichsweise kleiner Volumina eine gute und lang anhaltende Wirkung erzielt werden kann; die erfindungsgemäße Anwendung ist daher einfacher und anwenderfreundlicher als bisher bekannte Behandlungen der Demodikose.
Geeignete Zubereitungen sind:
Lösungen, beispielsweise Lösungen zum Gebrauch auf der Haut oder in Körperhöhlen, Aufgu߬ formulierungen, Gele;
Emulsionen und Suspensionen, halbfeste Zubereitungen.
Lösungen zum Gebrauch auf der Haut werden aufgeträufelt, aufgestrichen, eingerieben, aufge¬ spritzt, aufgesprüht. Diese Lösungen werden hergestellt, indem der Wirkstoff in einem geeigneten Lösungsmittel gelöst wird und eventuell Zusätze wie Lösungsvermittler, Säuren, Basen, Puffersalze, Antioxidantien, Konservierungsmittel zugefügt werden; auf steriles Arbeiten kann dabei verzichtet werden.
Als Lösungsmittel seien genannt: Physiologisch verträgliche Lösungsmittel wie Wasser, Alkohole wie Ethanol, Butanol, Benzylalkohol, Glycerin, Kohlenwasserstoffe, Propylenglykol, Polyethylen- glykole, N-Methylpyrrolidon, sowie Gemische derselben.
Die Wirkstoffe lassen sich gegebenenfalls auch in physiologisch verträglichen pflanzlichen oder synthetischen Ölen, die pharmazeutisch geeignet sind, lösen.
Als Lösungsvermittler seien genannt: Lösungsmittel, die die Lösung des Wirkstoffs im Haupt¬ lösungsmittel fördern oder sein Ausfallen verhindern. Beispiele sind Polyvinylpyrrolidon, poly- oxyethyliertes Rhizinusöl, polyoxyethylierte Sorbitanester.
Konservierungsmittel sind: Benzylalkohol, Trichlorbutanol, p-Hydroxybenzoesäureester, n- Butanol. Es kann vorteilhaft sein, bei der Herstellung Verdickungsmittel zuzufügen. Verdickungsmittel sind: Anorganische Verdickungsmittel wie Bentonite, kolloidale Kieselsäure, Alummiummono- stearat, organische Verdickungsmittel wie Cellulosederivate, Polyvinylalkohole und deren Copoly- mere, Acrylate und Metacrylate.
Gele werden auf die Haut aufgetragen oder aufgestrichen oder in Körperhöhlen eingebracht. Gele werden hergestellt, indem Lösungen, die wie oben beschrieben hergestellt worden sind, mit soviel Verdickungsmittel versetzt werden, dass eine klare Masse mit salbenartiger Konsistenz entsteht. Als Verdickungsmittel werden die weiter oben angegebenen Verdickungsmittel eingesetzt.
Aufgieß-Formulierungen werden auf begrenzte Bereiche der Haut aufgegossen oder aufgespritzt, wobei der Wirkstoff entweder die Haut durchdringt und systemisch wirkt oder sich auf der Körper¬ oberfläche verteilt.
Aufgieß-Formulierungen werden hergestellt, indem der Wirkstoff in geeigneten hautverträglichen Lösungsmitteln oder Lösungsmittelgemischen gelöst, suspendiert oder emulgiert wird. Gegebe¬ nenfalls werden weitere Hilfsstoffe wie Farbstoffe, resorptionsfördernde Stoffe, Antioxidantien, Lichtschutzmittel, Haftmittel zugefügt.
Als Lösungsmittel seien genannt: Wasser, Alkanole wie Ethanol, Isopropanol, 2-Hexyldecanol, Octyldodecanol und Tetrahydrofurfurylalkohol, Glykole wie Glycerol, Propylenglykol, PoIy- ethylenglykole, Polypropylenglykole, aromatisch substituierte Alkohole wie Benzylalkohol, Phenylethanol, Phenoxyethanol, Ester wie Essigester, Butylacetat, Benzylbenzoat, Dibutyladipat, Dicaprylylcarbonat, Diethylhexylcarbonat, Propylencarbonat, Ether wie Dicaprylylether, Alkylenglykolalkylether wie Dipropylenglycolmonomethylether, Diethylenglykolmonoethylether, Ketone wie Aceton, Methylethylketon, Methylisobutylketon, aromatische und/oder aliphatische Kohlenwasserstoffe, pflanzliche oder synthetische fette Öle wie Erdnussöl, Olivenöl, Rapsöl, Sesamöl, Sojaöl, Sonnenblumenöl, Glycerylricinoleat, Mittelkettige Triglyceride, Propylenglykol- dicaprylat/dicaprat, Propylenglykoldipelargonat und Propylenglykollaurat; andere Fettsäureester wie 2-Octyldodecylmyristat, Cetearylisononanoat, Cetearyloctanoat, Cetylethylhexanoat, Coco- caprylat/caprat, Decylcocoat, Decyloleat, Ethyloleat, Isocetylpalmitat, Isopropylmyristat, Isopropylpalmitat, Isostearylisostearat, Octylpahnitat, Octylstearat, Oleylerucat; Silikonöle wie Cethyldimethicon, Dimethicon und Simethicon; Dimethylformamid, Dimethylacetamid, Glycerolformal, Glycofurol, 2-Pyrrolidon, N-Methylpyrrolidon, 2-Dimethyl-4-hydroxy-methylen- 1,3-dioxolan, Dioctylcyclohexan.
Farbstoffe sind alle zur Anwendung am Tier zugelassenen Farbstoffe, die gelöst oder suspendiert sein können. Resorptionsfordernde Stoffe sind z.B. DMSO, spreitende Öle wie Isopropylmyristat, Isopropyl- palmitat, Dipropylenglykolpelargonat, Silikonöle, Fettsäureester, Triglyceride, Fettalkohole.
Antioxidantien sind Sulfite oder Metabisulfϊte wie Kaliummetabisulfat, Ascorbinsäure, Butyl- hydroxytoluol, Butylhydroxyanisol, Tocopherol.
Lichtschutzmittel sind z.B. Stoffe aus der Klasse der Benzophenone oder Novantisolsäure.
Haftmittel sind z.B. Cellulosederivate, Stärkederivate, Polyacrylate, natürliche Polymere wie Alginate, Gelatine.
Emulsionen sind entweder vom Typ Wasser in Öl oder vom Typ Öl in Wasser.
Sie werden hergestellt, indem man den Wirkstoff entweder in der hydrophoben oder in der hydro- philen Phase löst und diese unter Zuhilfenahme geeigneter Emulgatoren und gegebenenfalls weiterer Hilfsstoffe wie Farbstoffe, resorptionsfordernde Stoffe, Konservierungsstoffe, Antioxi¬ dantien, Lichtschutzmittel, viskositätserhöhende Stoffe, mit dem Lösungsmittel der anderen Phase homogenisiert.
Als hydrophobe Phase (Öle) seien genannt: Paraffϊnöle, Silikonöle, natürliche Pflanzenöle wie Sesamöl, Mandelöl, Rizinusöl, synthetische Triglyceride wie Capryl/Caprinsäure-triglycerid, Triglyceridgemisch mit Pflanzenfettsäure der Kettenlänge Cg.^ oder anderen speziell ausge¬ wählten natürlichen Fettsäuren, Partialglyceridgemische gesättigter oder ungesättigter eventuell auch hydroxylgruppenhaltiger Fettsäuren, Mono- und Diglyceride der Cg/C^Q-Fettsäuren.
Fettsäureester wie Ethylstearat, Di-n-butyryl-adipat, Laurinsäurehexylester, Dipropylen-glykol- pelargonat, Ester einer verzweigten Fettsäure mittlerer Kettenlänge mit gesättigten Fettalkoholen der Kettenlänge C^g-Cig, Isopropylmyristat, Isopropylpalmitat, Capryl/Caprüisäureester von gesättigten Fettalkoholen der Kettelänge C^-Cig, Isopropylstearat, Ölsäureoleylester, Ölsäure- decylester, Ethyloleat, Milchsäureethylester, wachsartige Fettsäureester wie künstliches
Entenbürzeldrüsenfett, Dibutylphthalat, Adipinsäurediisopropylester, letzterem verwandte Ester- gemische u.a.
Fettalkohole wie Isotridecylalkohol, 2-Octyldodecanol, Cetylstearyl-alkohol, Oleylalkohol.
Fettsäuren wie z.B. Ölsäure und ihre Gemische.
Als hydrophile Phase seien genannt: Wasser, Alkohole wie z.B. Ethanol, Isopropanol, Propylenglykol, Glycerol, Sorbitol und ihre Gemische.
Als Emulgatoren seien genannt: nichtionogene Tenside, z.B. polyoxyethyliertes Rizinusöl, poly- oxyethyliertes Sorbitan-monooleat, Sorbitanmonostearat, Glycerinmonostearat, Polyoxyethyl- stearat, Alkylphenolpolyglykolether;
ampholytische Tenside wie Di-Na-N-lauryl-ß-iminodipropionat oder Lecithin;
anionaktive Tenside, wie Na-Laurylsulfat, Fettalkoholethersulfate, Mono/Dialkylpolyglykolether- orthophosphorsäureester-monoethanolaminsalz;
kationaktive Tenside wie Cetyltrimethylammoniumchlorid.
Als weitere Hilfsstoffe seien genannt: Viskositätserhöhende und die Emulsion stabilisierende Stoffe wie Carboxymethylcellulose, Methylcellulose und andere Cellulose- und Stärke-Derivate, Polyacrylate, Alginate, Gelatine, Gummi-arabicum, Polyvinylpyrrolidon, Polyvinylalkohol, Copolymere aus Methylvinylether und Maleinsäureanhydrid, Polyethylenglykole, Wachse, kolloidale Kieselsäure oder Gemische der aufgeführten Stoffe.
Suspensionen werden hergestellt, indem man den Wirkstoff in einer Trägerflüssigkeit gegebenen¬ falls unter Zusatz weiterer Hilfsstoffe wie Netzmittel, Farbstoffe, resorptionsfördernde Stoffe, Konservierungsstoffe, Stabilisatoren, Antioxidantien Lichtschutzmittel suspendiert.
Als Trägerflüssigkeiten seien alle homogenen Lösungsmittel und Lösungsmittelgemische genannt.
Als Netzmittel (Dispergiermittel) seien die weiter oben angegebene Tenside genannt.
Als weitere Hilfsstoffe seien die weiter oben angegebenen genannt.
Halbfeste Zubereitungen unterscheiden sich von den oben beschriebenen Suspensionen und Emulsionen nur durch ihre höhere Viskosität.
Die makrocyclischen Lactone können auch in Kombination mit Synergisten oder mit weiteren Wirkstoffen vorliegen. Bevorzugt ist die Kombination mit Insektiziden aus der Gruppe der Agonisten der nicotinergen Acetylcholinrezeptoren von Insekten, und zwar vorzugsweise mit Neonicotinoiden. Mit solchen Kombinationen lassen sich neben der Demodikose auch ektopara- sitäre Insekten und Endoparasiten bekämpfen.
Unter Neonicotinoiden sollen insbesondere Verbindungen der Formel (I) verstanden werden: / (A)
R für Wasserstoff, gegebenenfalls substituierte Reste der Gruppe Acyl, Alkyl, Aryl, Aralkyl, Heteroaryl, Heteroarylalkyl oder Heterocyclylalkyl steht;
A für eine monofunktionelle Gruppe aus der Reihe Wasserstoff, Acyl, Alkyl, Aryl steht oder für eine bifunktionelle Gruppe steht, die mit dem Rest Z verknüpft ist;
E für einen elektronenziehenden Rest steht;
X für die Reste -CH= oder =N- steht, wobei der Rest -CH= anstelle eines H-Atoms mit dem Rest Z verknüpft sein kann;
Z für eine monofunktionelle Gruppe aus der Reihe Alkyl, -O-R, -S-R,
R für gleiche oder verschiedene Reste steht und die oben angegebene
Bedeutung hat, oder Z für eine bifunktionelle Gruppe steht, die mit dem Rest A oder dem Rest X verknüpft ist.
Besonders bevorzugt sind Verbindungen der Formel (I), in welcher die Reste folgende Bedeutung haben:
R steht für Wasserstoff sowie für gegebenenfalls substituierte Reste aus der Reihe Acyl, Alkyl, Aryl, Aralkyl, Heteroaryl, Heteroarylalkyl, Heterocyclylalkyl.
Als Acylreste seien genannt Formyl, (Ci.8-Alkyl)-carbonyl, (C6-io-Aryl)-carbonyl, (C1-8- Alkyl)-sulfonyl, (C6,i0-Aryl)-sulfonyl, (Ci-8-Alkyl)-(C6-io-Aryl)-phosphoryl, die ihrerseits substituiert sein können. Als Alkyl seien genannt Cj.io-Alkyl, insbesondere C1-4-AIlCyI, im einzelnen Methyl, Ethyl, i-Propyl, sec- oder t.-Butyl, die ihrerseits substituiert sein können.
Aryl ist insbesondere Cö-io-Aryl, als Beispiele seien genannt Phenyl, Naphthyl, insbesondere Phenyl.
Aralkyl ist insbesondere (C6.io-Aryl)-(Ci.4-Alkyl), als Beispiele seien genannt Phenyl- methyl, Phenethyl.
Als Heteroaryl seien genannt Heteroaryl mit bis zu 10 Ringatomen und N, O, S insbe¬ sondere N als Heteroatomen. Im einzelnen seien genannt Thienyl, Furyl, Thiazolyl, Imidazolyl, Pyridyl, Benzthiazolyl.
Heteroarylalkyl ist insbesondere Heteroaryl-(Ci.4-Alkyl), wobei Heteroaryl wie vorstehend definiert ist. Als Beispiele seien genannt Heteroarylmethyl, Heteroarylethyl mit bis zu 6 Ringatomen und N, O, S, insbesondere N als Heteroatomen.
Heterocyclyl ist insbesondere ein ungesättiger aber nicht aromatischer oder gesättigter Heterocyclus mit bis zu 6 Ringatomen, enthaltend bis zu 3 Heteroatome ausgewählt aus N, O, S, zum Beispiel Tetrahydrofuryl.
Heterocyclylalkyl ist insbesondere Heterocyclyl-Ci-2-Alkyl, z.B.: Tetrahydrofuranylmethyl und Tetrahydrofuranylethyl.
Als Substituenten seien beispielhaft und vorzugsweise aufgeführt:
Alkyl mit vorzugsweise 1 bis 4, insbesondere 1 oder 2 Kohlenstoffatomen, wie Methyl, Ethyl, n- und i-Propyl und n-, i- und t-Butyl; Alkoxy mit vorzugsweise 1 bis 4, insbeson¬ dere 1 oder 2 Kohlenstoffatomen, wie Methoxy, Ethoxy, n- und i-Propyloxy und n-, i- und t-Butyloxy; Alkylthio mit vorzugsweise 1 bis 4, insbesondere 1 oder 2 Kohlenstoffatomen, wie Methylthio, Ethylthio, n- und i-Propylthio und n-, i- und t-Butylthio; Halogenalkyl mit vorzugsweise 1 bis 4, insbesondere 1 oder 2 Kohlenstoffatomen und vorzugsweise 1 bis 5, insbesondere 1 bis 3 Halogenatomen, wobei die Halogenatome gleich oder verschieden sind und als Halogenatome, vorzugsweise Fluor, Chlor oder Brom, insbesondere Fluor stehen, wie Trifluormethyl; Hydroxy; Halogen, vorzugsweise Fluor, Chlor, Brom und Jod, insbesondere Fluor, Chlor und Brom; Cyano; Nitro; Amino; Monoalkyl- und Dialkylamino mit vorzugsweise 1 bis 4, insbesondere 1 oder 2 Kohlenstoffatomen je Alkylgruppe, wie Methylamino, Methyl-ethyl-amino, n- und i-Propylamino und Methyl-n-butylamino;
Carboxyl; Carbalkoxy mit vorzugsweise 2 bis 4, insbesondere 2 oder 3 Kohlenstoffatomen, wie Carbomethoxy und Carboethoxy; Sulfo (-SO3H); Alkylsulfonyl mit vorzugsweise 1 bis 4, insbesondere 1 oder 2 Kohlenstoffatomen, wie Methylsulfonyl und Ethylsulfonyl; Arylsulfonyl mit vorzugsweise 6 oder 10 Arylkohlenstoffatomen, wie Phenylsulfonyl sowie Heteroarylamino und Heteroarylalkylamino wie Chlorpyridylamino und Chlor- pyridylmethylamino.
A steht besonders bevorzugt für Wasserstoff sowie für gegebenenfalls substituierte Reste aus der Reihe Acyl, Alkyl, Aryl, die bevorzugt die bei R angegebenen Bedeutungen haben. A steht ferner für eine bifunktionelle Gruppe. Genannt sei gegebenenfalls substituiertes Alkylen mit 1-4, insbesondere 1-2 C-Atomen, wobei als Substituenten die weiter oben aufgezählten Substituenten genannt seien und wobei die Alkylengruppen durch
Heteroatome aus der Reihe N, O, S unterbrochen sein können.
A und Z können gemeinsam mit den Atomen, an welche sie gebunden sind, einen gesättigten oder ungesättigten heterocyclischen Ring bilden. Der heterocyclische Ring kann weitere 1 oder 2 gleiche oder verschiedene Heteroatome und/oder Heterogruppen enthalten. Als Hetero- atome stehen vorzugsweise Sauerstoff, Schwefel oder Stickstoff und als Heterogruppen N-
Alkyl, wobei Alkyl der N-Alkyl-Gruppe vorzugsweise 1 bis 4, insbesondere 1 oder 2 Kohlenstoffatome enthält. Als Alkyl seien Methyl, Ethyl, n- und i-Propyl und n-, i- und t- Butyl genannt. Der heterocyclische Ring enthält 5 bis, 7, vorzugsweise 5 oder 6 Ring¬ glieder.
Als Beispiele für den heterocyclischen Ring seien Pyrrolidin, Piperidin, Piperazin, Hexa- methylenimin, Hexahydro-l,3,5-triazin, Morpholin und Oxadiazin genannt, die gegebe¬ nenfalls bevorzugt durch Methyl substituiert sein können.
E steht für einen elektronentziehenden Rest, wobei insbesondere NO2, CN, HaIo- genalkylcarbonyl wie Halogen-Ci_4-alkylcarbonyl mit 1 bis 9 Halogenatomen, insbeson- dere COCF3, sowie Ci_4-Alkylsulfonyl und Halogen-Ci_4_alkylsulfonyl mit 1 bis 9
Halogenatomen, insbesondere SO2CF3, genannt seien.
X steht für -CH= oder -N=
Z steht für gegebenenfalls substituierte Reste Alkyl, -OR, -SR, -NRR, wobei R und die
Substituenten bevorzugt die oben angegebene Bedeutung haben.
Z kann außer dem obengenannten Ring gemeinsam mit dem Atom, an welches es gebunden
ist und dem Rest r=: C — an der Stelle von X einen gesättigten oder ungesättigten heterocyclischen Ring bilden. Der heterocyclische Ring kann weitere 1 oder 2 gleiche oder verschiedene Heteroatome und/oder Heterogruppen enthalten. Als Heteroatome stehen vorzugsweise Sauerstoff, Schwefel oder Stickstoff und als Heterogruppen N-Alkyl, wobei die Alkyl oder N-Alkyl- Gruppe vorzugsweise 1 bis 4, insbesondere 1 oder 2 Kohlenstoffatome enthält. Als Alkyl seien Methyl, Ethyl, n- und i-Propyl und n-, i- und t-Buryl genannt. Der heterocyclische Ring enthält 5 bis 7, vorzugsweise 5 oder 6 Ringglieder.
Als Beispiele für den heterocyclischen Ring seien Pyrrolidin, Piperidin, Piperazin, Hexa- methylenimin, Morpholin und N-Methylpiperazin genannt.
Als ganz besonders bevorzugt erfindungsgemäß verwendbare Verbindungen seien Verbindungen der allgemeinen Formeln (II), (DI) und (FV) genannt:



für 1 oder 2 steht,
m für 0, 1 oder 2 steht, Subst. für einen der oben aufgeführten Substituenten, insbesondere für Halogen, ganz besonders für Chlor, steht,
A, Z, X und E die oben angegebenen Bedeutungen haben.
Im einzelnen seien folgende Verbindungen genannt:







Im einzelnen seien folgende besonders bevorzugte Verbindungen genannt:

Imidacloprid AKD 1022



Thiamethoxam (Diacloden) Dinotefuran
Neben nicotinischen Agonisten aus der Gruppe der Neonicotinoide können erfindungsgemäß auch andere nicotinische Agonisten eingesetzt werden.
Anwendungsfertige Zubereitungen der erfindungsgemäß verwendbaren Mittel enthalten üblicher- weise die Wirkstoffe jeweils in Konzentrationen von 10 ppm bis 30 % m/m; das makrocyclische Lacton wird bevorzugt in Konzentrationen von 0,01 bis 15 % m/m, besonders bevorzugt 0,02 bis 10 % m/m eingesetzt; das Neonicotinoid wird bevorzugt in Konzentrationen von 1 bis 20 % m/m, besonders bevorzugt 5-15 % m/m eingesetzt.
Zubereitungen die vor Anwendung verdünnt werden, enthalten die Wirkstoffe in entsprechend höheren Konzentrationen, z. B. 0,5 bis 90 % m/m, vorzugsweise 5 bis 50 % m/m.
Im Allgemeinen hat es sich als vorteilhaft erwiesen, Mengen von etwa 0,01 bis 100 mg Wirkstoff je kg Körperge wicht pro Tag zur Erzielung wirksamer Ergebnisse zu verabreichen, bevorzugte übliche Tagesdosen liegen beim makrocyclischen Lacton im Bereich von 0,05 bis 10 mg/kg, besonders bevorzugt 0,1 bis 8 mg/kg; falls ein Neonicotinoid eingesetzt wird, liegen übliche Tagesdosen bevorzugt im Bereich 1 bis 20 mg/kg, besonders bevorzugt bei 5-10 mg/kg. Erfindungsgemäß besonders bevorzugt sind pour-on- oder spot-on-Formulierungen. Diese werden in vergleichsweise kleinen Mengen von üblicherweise 0.1 bis 20 ml, vorzugsweise 0.4 bis 10 ml auf einen kleinen Teil der Körperoberfläche des zu behandelnden Tieres aufgebracht.
Solche Formulierungen enthalten das makrocyclische Lacton in Mengen von 0,01 bis 10 % m/m, bevorzugt 0,02 bis 8 % m/m.
Der Gehalt an Neonicotinoid — sofern dieses eingesetzt wird - liegt üblicherweise bei 1-20 % m/m, bevorzugt bei 5-15 % m/m.
Als Lösungsmittel für die pour-on oder spot-on Formulierungen eignen sich die oben genannten Lösungsmittel.
Bevorzugt sind hierbei Lösungsmittel, die über sehr gute Lösungseigenschaften für makrocylische Laktone verfügen wie Ethanol, Isopropanol, Propylenglykol, 2-Hexyldecanol, Octyldodecanol, Dibutyladipat, Mittelkettige Triglyceride, Propylenglykoldicaprylat/dicaprat, Propylenglykollaurat, Isopropylmyristat, Isopropylpalmitat, Propylencarbonat, Dipropylenglycolmonomethylether, Diethylenglykolmonoethylether und Ketone.
Bevorzugt sind auch Lösungsmittel, die über gute Spreiteigenschaften verfügen, wie 2- Hexyldecanol, Octyldodecanol, 2-Octyldodecylmyristat, Cetearylisononanoat, Cetearyloctanoat, Cetylethylhexanoat, Coco-caprylat/caprat, Decylcocoat, Decyloleat, Ethyloleat, Isocetylpalmitat, Isopropylmyristat, Isopropylpalmitat, Isostearylisostearat, Octylpalmitat, Octylstearat, Oleylerucat, Mittelkettige Triglyceride, Propylenglykoldicaprylat/dicaprat, Dipropylenglycolmonomethylether, Diethylenglykolmonoethylether, Cetyldimethicon, Dimethicon und Simethicon.
Besonders bevorzugt sind hierbei Lösungsmittel, die über gute Löseeigenschaften für makro¬ cylische Laktone und über gute Spreiteigenschaften verfügen, wie 2-Hexyldecanol, Octyl¬ dodecanol, Dibutyladipat, Dipropylenglycolmonomethylether, Diethylenglykolmonoethylether, Mittelkettige Triglyceride, Propylenglykoldicaprylat/dicaprat, Propylenglykollaurat, Isopropyl- myristat und Isopropylpalmitat.
Die Lösungsmittel können alleine oder auch in Kombination eingesetzt werden. Ihre Gesamt¬ konzentration liegt üblicherweise zwischen 10 und 98 % m/m, bevorzugt zwischen 30 und 95% m/m.
Die bevorzugten Spot-on- oder Pour-on-Formulierungen können darüber hinaus übliche pharma- zeutische Zusatz- und Hilfsmittel enthalten. Spot-on- oder Pour-on-Formulierungen können auch als Emulsionskonzentrate formuliert werden. Hierbei sind die Wirkstoffe in erhöhter Konzentration in einem Lösungsmittel zusammen mit einem Dispergierhilfsmittel gelöst. Der Anwender gibt eine bestimmte Menge dieses Konzentrates in Wasser, worauf sich spontan oder nach Umschütteln eine Emulsion bildet. Als Lösungsmittel können die oben- genannten Stoffe und als Dispergierhilfsmittel die ebenfalls oben genannten ionogenen und nicht-ionogenen Emulgatoren eingesetzt werden.
Falls die makrocyclischen Lactone in Kombination mit anderen Wirkstoffen angewendet werden bedeutet dies entweder, dass die makrocyclischen Lactone und der oder die weiteren Wirkstoffe getrennt oder zeitlich abgestuft angewendet werden können. In diesem Fall sind die makro- cyclischen Lactone und die weiterhin eingesetzten Wirkstoffe jeweils als gesonderte Arzneimittel formuliert. Ebenfalls möglich ist die gleichzeitige Anwendung; erfmdungsgemäß ist es bevorzugt, dass makrocycliches Lacton und weiterer Wirkstoff gemeinsam in einem Mittel formuliert sind.
Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform können die in WO 00/30449 beschriebenen Formu¬ lierungen verwendet werden, auf dieses Dokument wird hiermit ausdrücklich Bezug genommen. Die dort beschriebenen Formulierungen eignen sich insbesondere zur Spot-on Applikation. Diese Formulierungen enthalten:
(a) 0,1 bis 50 % w/v, bevorzugt 1 bis 16 % w/v, besonders bevorzugt 4 bis 12 % w/v, ganz besonders bevorzugt 6 bis 12 % w/v eines makrocyclischen Lactons
(b) 1 bis 50 % v/v, bevorzugt bis zu 20 % v/v, besonders bevorzugt 2 bis 16 % v/v, ganz besonders bevorzugt 4 bis 12 % v/v, insbesondere 6 bis 12 % v/v eines Di-(C2-4-
(c) gegebenenfalls ein Antioxidans
(d) gegebenenfalls ein hautverträgliches flüchtiges Lösungsmittel q.s. v/v
(„w/v" bedeutet Gewicht/Volumen, 1 % w/v bedeutet 1 g in 100 ml der Formulierung)
Die Formulierung eignet sich für die weiter oben näher beschriebenen makrocyclischen Lactone, insbesondere für Selamectin.
Bei dem Di-(C2-4-Glycol)mono(Ci-4-alkyl)ether handelt es sich bevorzugt um Diethylenglycol- monomethylether oder insbesondere Dipropylenglycolrnonomethylether.
Bevorzugt enthält die Formulierung das hautverträgliche flüchtige Lösungsmittel, bevorzugte Beispiele sind Ethanol und insbesondere Isopropanol. Als Antioxidans kommen beispielsweise Propylgallat, BHA (2-tert.-Butyl-4-methoxyphenol) oder insbesondere BHT (2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol) in Frage. Üblicherweise ist das Antioxidans in Konzentrationen von 0,2% w/v oder weniger, bevorzugt 0,1 % w/v oder weniger, in den Formulierungen enthalten.
Gemäß einer besonders bevorzugten weiteren Ausführungsform eignet sich die folgende Basis für erfindungsgemäß einsetzbare Formulierungen, insbesondere spot-on Formulierungen:
Als Lösungsmittel A wird Benzylalkohol oder ein gegebenenfalls substituiertes Pyrrolidon, eingesetzt. Gegebenenfalls substituierte Pyrrolidone sind z. B. 2-Pyrrolidon; l-(Ci-Cio)-Pyrrolidon- 2 wie 1-Methylpyrrolidon, 1-Ethylpyrrolidon, 1-Octylpyrrolidon, 1-Dodecylpyrrolidon, 1-Iso- propylpyrrolidon, l-(n-, sek.- oder tert.-Butyl)-Pyrrolidon, 1-Hexylpyrrolidon; l(C2-Ci0-Alkenyl)- pyrrolidon-2 wie l-Vinylpyrrolidon-2; l-(C.3-C8-Cycloalkyl)-pyrrolidon-2 wie 1-Cyclohexyl- pyrrolidon; l-(3-Hydroxypropyl)-pyrrolidon, l-(2-Methoxyethyl)-pyrrolidon, l-(3-Methoxy- proypl)-pyrrolidon, 1-Benzylpyrrolidon. Von diesen besonders bevorzugt ist Benzylalkohol.
Bevorzugt ist die Verwendung des Lösungsmittels A als Gemisch mit einem Co-Lösungsmittel B ausgewählt aus der Gruppe der cyclischen Carbonate und Lactone (bevorzugte Beispiele sind γ- Butyrolacton, Ethylencarbonat und insbesondere Propylencarbonat) wobei Lösungsmittel A einen Anteil von 20 bis 99 % m/m, bevorzugt 40 bis 90 % m/m, besonders bevorzugt 50 bis 90 % m/m und Lösungsmittel B entsprechend 1 bis 80 % m/m, bevorzugt 10 bis 60 % m/m, besonders bevor¬ zugt 10 bis 50 % m/m hat.
In dem Lösungsmittel oder Lösungsmittelgemisch sind der oder die Wirkstoffe sowie gegebe¬ nenfalls weitere Hilfs- und Zusatzstoffe gelöst.
Formulierungen dieser Art eignen sich beispielsweise besonders für Ivermectin oder Moxidectin gegebenenfalls in Kombination mit einem Neonicotinoid wie ünidacloprid.
Die erfindungsgemäße topische Behandlung der Demodikose mit makrocyclischen Lactonen ermöglicht eine einfache und bequeme aber dennoch effektive Behandlung der Krankheit. Üblicherweise genügen Applikationen im Abstand von mindestens einer Woche, bevorzugt mindestens zwei Wochen, besonders bevorzugt mindesten drei Wochen, insbesondere alle vier Wochen um gute Behandlungserfolge zu erzielen. Die Behandlung dauert in der Regel 2 bis 4 Monate.
Die folgenden Beispiele für erfindungsgemäß verwendbare Formulierungen erläutern die Erfindung ohne sie in irgendeiner Weise zu begrenzen: Beispiele
6 % w/v Selamectin
6 % v/v Dipropylenglykolmonomethylether 0,08% w/v BHT q.s. 100 % v/v Isopropanol
12 % w/v Selamectin
12 % v/v Dipropylenglykolmonomethylether
0,08% w/v BHT q.s. 100 % v/v Isopropanol
100 ml Formulierung enthalten:
6,0 g Selamectin
5,63 g Dipropylenglykolrnonomethylether
69,79 g ; Isopropanol
100 ml Formulierung enthalten:
5,63 g Dipropylenglykolmonomethylether 0,08 g BHT
69,8 g Isopropanol Beispiel 5
10,0 g Imidacloprid
0,08 g Ivermectin
83,1 g Benzylalkohol 16,5 g Propylencarbonat
10,0 g Imidacloprid 0,20 g Ivermectin
83,2 g Benzylalkohol
16,3 g Propylencarbonat
10,0 g Imidacloprid
2,5 g Moxidectin
80,7 g Benzylalkohol
16,5 g Propylencarbonat 0,10 g BHT
10,0 g Imidacloprid
1,0 g Moxidectin 82,2 g Benzylalkohol
16,5 g Propylencarbonat
0,10 g BHT Biologisches Beispiel
Feldstudie: Behandlung der Demodikose bei Hunden
Bei 23 Hunden wurde eine generalisierte Demodikose mit Advocate ® spot-on (100 mg Imida- cloprid und 25 mg Moxidectin pro ml) behandelt. Das Mittel wurde am Tag 0 und 28 jeweils ein Mal für 4 Wochen appliziert, Hunde bei denen sich am Tag 28 oder 56 noch Demodex-Milben nachweisen ließen wurden ein drittes Mal behandelt, Hunde bei denen am Tag 56 oder 84 noch Demodex-Milben nachgewiesen werden konnten wurden ein viertes Mal behandelt.
87 % der Hunde waren am Ende der Behandlung milbenfrei, bei den übrigen Hunden konnten deutliche Verbesserungen des Krankheitsbildes festgestellt werden.
Als Vergleich wurde in dieser Studie das Produkt Interceptor ® (Tabletten enthaltend Milbe- mycinoxim) getestet. Diese Tabletten wurden täglich oral über 2 bis 4 Monate verabreicht. Die Ergebnisse bei der Demodikose-Behandlung waren denen mit Advocate vergleichbar, allerdings ist die spot-on Applikation einmal in 4 Wochen von Advocate ® deutlich ein¬ facher und bequemer als die tägliche Tablettengabe bei Interceptor ® .
Priority Applications (2)
Applications Claiming Priority (2)
Publications (1)
ID=35614662
Family Applications (1)
Country Status (4)
Cited By (3)
Families Citing this family (1)
Citations (3)
Family Cites Families (13)
Patent Citations (3)
Non-Patent Citations (6)
Cited By (4)
Also Published As
Similar Documents
Legal Events
Kind code of ref document: A1
Designated state(s): AE AG AL AM AT AU AZ BA BB BG BR BW BY BZ CA CH CN CO CR CU CZ DE DK DM DZ EC EE EG ES FI GB GD GE GH GM HR HU ID IL IN IS JP KE KG KM KN KP KR KZ LC LK LR LS LT LU LV LY MA MD MG MK MN MW MX MZ NA NG NI NO NZ OM PG PH PL PT RO RU SC SD SE SG SK SL SM SY TJ TM TN TR TT TZ UA UG US UZ VC VN YU ZA ZM ZW
Kind code of ref document: A1
Designated state(s): GM KE LS MW MZ NA SD SL SZ TZ UG ZM ZW AM AZ BY KG KZ MD RU TJ TM AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LT LU LV MC NL PL PT RO SE SI SK TR BF BJ CF CG CI CM GA GN GQ GW ML MR NE SN TD TG
Ref document number: 2005802055
Country of ref document: EP
Ref document number: 11718914
Country of ref document: US
Ref document number: 2005304103
Country of ref document: AU
Ref document number: 2005304103
Country of ref document: AU
Date of ref document: 20051027
Kind code of ref document: A
Ref document number: 2005802055
Country of ref document: EP
Ref document number: 11718914
Country of ref document: US
Ref document number: PI0517966
Country of ref document: BR
Demodikose hund
Die vorliegende Erfindung betrifft die Verwendung von makrocyclischen Lactonen zur Behandlung von Demodikose, insbesondere beim Hund.
Krieger, Klemens, Dr. (Lindlar, 51789, DE)
Die vorliegende Erfindung betrifft die Verwendung von makrocyclischen Lactonen zur Behandlung von Demodikose, insbesondere beim Hund.
Makrocyclische Lactone sind vor allem in der Veterinärmedizin bekannt als Mittel, die sowohl hervorragende endoparasitizide Wirkung sowie in gewissen Grenzen auch ektoparasitizide Wirkung aufweisen. So ist z.B. eine Wirkung gegen ektoparasitäre Arthropoden bekannt.
Bei der Demodikose, insbesondere des Hundes, wird zwischen einer juvenilen in der Regel selbst heilenden lokalen Erkrankung (engl.: „localized demodicosis") und einer beim erwachsenen Tier auftretenden generalisierten Erkrankung (engl.: „generalized demodicosis") unterschieden. Die generalisierte Demodikose stellt eine schwere klinische Erkrankung dar, die äußerst schwierig zu therapieren ist. Zur Therapie der Demodikose wurden zunächst Waschungen mit acariziden Mitteln, z.B. Ronnel (O,O-dimethyl O-(2,4,5-trichlorphenyl) phosphorothioat) eingesetzt, die jedoch wegen eines hohen Vergiftungsrisikos bei Hund und Anwender abzulehnen sind. Modernere Mittel sind Waschungen mit Amitraz ((N'-(2,4-dimethylphenyl)-N[[(2,4-dimethylphenyl)imino]methyl]-methanimidamide) in 1-2 wöchigem Abstand. Ebenfalls erfogreich angewendet werden makrozyklische Laktone, die in täglichen bis wöchentlichen oder 2 wöchentlichen Abstand oral oder per injectionem verabreicht werden. Diese Behandlungsprogramme sind teuer für den Tierhalter und unbequem für Hund und Halter, der Erfolg ist nicht sicher. Die Spot-on Behandlung 3mal pro Woche mit Ivermectin wurde im Stand der Technik als nicht ausreichend wirksam beschrieben. Der Stand der Technik bezüglich der Demodikose-Behandlung ist dargestellt in: R. S. Mueller, Veterinary Dermatology, 15 (2004) 75-89; M. Paradis, Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice, 29(6) (1999) 1425-1436.
Überraschenderweise wurde nun gefunden, dass auch bei äußerlicher Anwendung makrocyclischer Lactone eine gute Wirkung gegen Demodikose erreicht werden kann.
Die Erfindung betrifft daher die Verwendung von makrocyclischen Lactonen zur Herstellung von Arzneimitteln zur äußerlichen Anwendung zur Behandlung von Demodikose.
Makrocyclische Lactone im Sinne dieser Erfindung sind insbesondere Avermectine, 22,23-Dihydroavermectine B1 (Ivermectine) oder Milbemycine.
Avermectine wurden aus dem Mikroorganismus Streptomyces avermitilis als mikrobielle Metabolite isoliert (US-Pat. 4 310 519) und können im wesentlichen als Gemisch, bestehend aus den acht Komponenten A1a, A1b, A2a, A2b, B1a, B1b, B2a und B2b, auftreten (I. Putter et al. Experentia 37 (1981) S. 963, Birkhäuser Verlag (Schweiz)). Daneben besitzen auch die synthetischen Derivate, insbesondere das 22,23-Dihydroavermectin B1 (Ivermectin), Interesse (US-Pat. 4 199 569). Milbemycin B-41 D konnte ebenso fermentativ aus Streptomyces hygroscopicus isoliert werden (vgl. "Milbemycin: Discovery and Development" I. Junya et al. Annu. Rep. Sankyo Res. Lab. 45 (1993), S. 1-98; JP-Pat. 8 378 549; GB 1 390 336 ).
Der Einsatz von Avermectinen, 22,23 Dihydroavermectinen B1 (Ivermectinen) und Milbemycinen aus der Klasse der makrocyclischen Lactone als Endoparasitizide ist lange bekannt und Gegenstand zahlreicher Patentanmeldungen sowie Übersichtsartikel (z. B. Biologische Wirkungen in: "Ivermectin and Abamectin" W. C. Campbell, Ed., Springer Verlag, New York, N. Y., 1989; "Avermectins and Milbemycins Part II" H. G. Davies et al. Chem. Soc. Rev. 20 (1991) S. 271-339; Chemische Modifikationen in: G. Lukacs et al. (Eds.), Springer-Verlag, New York, (1990), Chapter 3; Cydectin TM [Moxidectin und Derivate]: G. T. Carter et al. J. Chem. Soc. Chem. Commun. (1987), S. 402-404); EP 423 445-A1). Der Einsatz von Doramectin (Pfizer) als Endoparasitizid ist ebenso bekannt (vgl. "Doramectin – a potent novel endectozide" A. C. Goudie et al. Vet. Parasitol. 49 (1993), S. 5-15).
Bei den Avermectinen handelt es sich um Stoffe oder Stoffgemische von makroliden Lactonen der allgemeinen Formel (I) in welcher
die Reste R 1 bis R 4 die in der nachfolgenden Tabelle 1 angegebene Bedeutung haben und X für eine Einfach- oder Doppelbindung zwischen der C22- und C23-Position (-C22R 1 -X-C23R 2 -) stehen kann.
Im Falle einer Doppelbindung befinden sich keine Substituenten (R 1 , R 2 ) an der C22- und C23-Position.
22,23-Dihydroavermectin B1 steht für Ivermectin B1;
sec-Bu = sekundär Butyl; iso-Pr = Isopropyl; Chx = Cyclohexyl; -Me = Methyl
Die Avermectine und 22,23-Dihydroavermectine B1 (Ivermectine) der allgemeinen Formel (I) werden in der Regel als Gemische eingesetzt. Von besonderem Interesse ist hierbei das Produkt Abamectin, das im wesentlichen die Avermectine B1 enthält, und deren Hydrierungsprodukte die 22,23-Dihydroavermectine B1 (Ivermectin).
Die mit "b" bezeichneten Verbindungen der makrocyclischen Lactone, die in der C25-Position einen iso-Propylrest besitzen, müssen nicht notwendiger Weise von den "a" Verbindungen, welche eine sec-Butylgruppe in der C25 -Position haben, getrennt werden. Es wird generell das Gemisch beider Substanzen, bestehend aus > 80% m/m sec-Butylderivat (B1a) und < 20% m/m iso-Propylderivat (B1b) isoliert, und kann erfindungsgemäß verwendet werden. Zudem können bei den Stereoisomeren die Substituenten in der C13- und C23-Position sowohl α- als auch β-ständig am Ringsystem angeordnet sein, d. h. sich oberhalb oder unterhalb der Molekülebene befinden. In jedem Fall werden alle Stereoisomeren erfindungsgemäß berücksichtigt. Die 4:1-Mischung von Avermectin B1a und Avermectin B1b wird in der Literatur als Abamectin bezeichnet.
Weiterhin leitet sich das semisynthetische makrocyclische Lacton Selamectin (5-Hydroxyimino-25-Cyclohexyl-Avermectin B1-Monosaccharid) von den Avermectinen ab:
Ebenfalls von den Avermectinen leitet sich Eprinomectin ((4''R)-4''-(Acetylamino)-4''-deoxyavermectin B1) ab; unter dieser Bezeichnung versteht man ein Mischung von 90% oder mehr der Komponente B1a und 10% oder weniger der Komponente B1b: Komponente B1a: R = C2H5
Die Milbemycine haben die gleiche makrolide Ringstruktur wie Avermectine oder 22,23-Dihydroavermectine B1 (Ivermectine), tragen aber keinen Substituenten (d.h. fehlendes Oleandrose Disaccharidfragment) in Position 13 (R 5 = Wasserstoff).
Beispielhaft seien als Milbemycine aus der Klasse der macrocyclischen Lactone die Verbindungen mit der allgemeinen Formel (II) genannt in welcher
die Reste R 1 bis R 5 die in der nachfolgenden Tabelle 2 angegebene Bedeutung haben: Tabelle 2 iso-Pr = Isopropyl
Im Zusammenhang mit den Milbemycinen sei auch das Milbemycin-Oxim genannt, das in der Regel als Mischung von 80% Milbemycin A4 5-Oxim und 20% Milbemycin A3 5-Oxim eingesetzt wird: Milbemycin A4 Oxim: R = -CH2CH3
Von den vorstehend genannten makrocyclischen Lactonen sind erfindungsgemäß die nachfolgenden von besonderem Interesse:
Soweit anwendbar werden im Sinne der Erfindung unter den Wirkstoffen auch deren pharmazeutisch annehmbare Salze, Hydrate und Prodrugs verstanden.
Die vorstehend genannten Wirkstoffe können gegebenenfalls in Abhängigkeit von der Art und Anzahl der Substituenten in Form von Stereoisomeren, z.B. geometrische und/oder optische Isomere, oder Regioisomeren oder in Form von entsprechenden Isomerengemischen unterschiedlicher Zusammensetzung vorliegen. Sowohl die reinen Isomeren als auch die Isomerengemische mit entsprechender Wirkung können erfindungsgemäß eingesetzt werden.
Die Demodikose ist eine spezielle Form der auch als Räude bezeichneten Krankheit („Demodex-Räude") und wird durch die Haarbalgmilben Demodex spp., insbesondere z.B. Demodex canis, hervorgerufen.
Die Demodikose kann bei verschiedenen Haus- und Nutztieren, wie z.B. bei Rindern oder Katzen auftreten, ist aber vor allem bei Hunden von besonderer Bedeutung. Erfindungsgemäß ist daher die Behandlung von Hunden bevorzugt.
Die Anwendung kann sowohl prophylaktisch als auch therapeutisch erfolgen.
Es hat sich gezeigt, dass unerwarteterweise auch bei äußerlicher Anwendung der makrocyclischen Lactone eine gute und lang anhaltende Wirkung gegen die Demodikose des Hundes erreicht werden kann.
Die äußerliche Anwendung geschieht üblicherweise in Form des Aufgießens (pour-on and spot-on) eines kleinen Volumens, beispielsweise von 1-10 ml, auf einen Teil der Körperoberfläche des zu behandelnden Tieres. Besonders überraschend war dabei, dass gerade bei äußerlicher Applikation vergleichsweise kleiner Volumina eine gute und lang anhaltende Wirkung erzielt werden kann; die erfindungsgemäße Anwendung ist daher einfacher und anwenderfreundlicher als bisher bekannte Behandlungen der Demodikose.
Geeignete Zubereitungen sind:
Lösungen, beispielsweise Lösungen zum Gebrauch auf der Haut oder in Körperhöhlen, Aufgußformulierungen, Gele;
Emulsionen und Suspensionen, halbfeste Zubereitungen.
Lösungen zum Gebrauch auf der Haut werden aufgeträufelt, aufgestrichen, eingerieben, aufgespritzt, aufgesprüht. Diese Lösungen werden hergestellt, indem der Wirkstoff in einem geeigneten Lösungsmittel gelöst wird und eventuell Zusätze wie Lösungsvermittler, Säuren, Basen, Puffersalze, Antioxidantien, Konservierungsmittel zugefügt werden; auf steriles Arbeiten kann dabei verzichtet werden.
Als Lösungsmittel seien genannt: Physiologisch verträgliche Lösungsmittel wie Wasser, Alkohole wie Ethanol, Butanol, Benzylalkohol, Glycerin, Kohlenwasserstoffe, Propylenglykol, Polyethylenglykole, N-Methylpyrrolidon, sowie Gemische derselben.
Die Wirkstoffe lassen sich gegebenenfalls auch in physiologisch verträglichen pflanzlichen oder synthetischen Ölen, die pharmazeutisch geeignet sind, lösen.
Als Lösungsvermittler seien genannt: Lösungsmittel, die die Lösung des Wirkstoffs im Hauptlösungsmittel fördern oder sein Ausfallen verhindern. Beispiele sind Polyvinylpyrrolidon, polyoxyethyliertes Rhizinusöl, polyoxyethylierte Sorbitanester.
Konservierungsmittel sind: Benzylalkohol, Trichlorbutanol, p-Hydroxybenzoesäureester, n-Butanol.
Es kann vorteilhaft sein, bei der Herstellung Verdickungsmittel zuzufügen. Verdickungsmittel sind: Anorganische Verdickungsmittel wie Bentonite, kolloidale Kieselsäure, Aluminiummonostearat, organische Verdickungsmittel wie Cellulosederivate, Polyvinylalkohole und deren Copolymere, Acrylate und Metacrylate.
Gele werden auf die Haut aufgetragen oder aufgestrichen oder in Körperhöhlen eingebracht. Gele werden hergestellt, indem Lösungen, die wie oben beschrieben hergestellt worden sind, mit soviel Verdickungsmittel versetzt werden, dass eine klare Masse mit salbenartiger Konsistenz entsteht. Als Verdickungsmittel werden die weiter oben angegebenen Verdickungsmittel eingesetzt.
Aufgieß-Formulierungen werden auf begrenzte Bereiche der Haut aufgegossen oder aufgespritzt, wobei der Wirkstoff entweder die Haut durchdringt und systemisch wirkt oder sich auf der Körperoberfläche verteilt.
Aufgieß-Formulierungen werden hergestellt, indem der Wirkstoff in geeigneten hautverträglichen Lösungsmitteln oder Lösungsmittelgemischen gelöst, suspendiert oder emulgiert wird. Gegebenenfalls werden weitere Hilfsstoffe wie Farbstoffe, resorptionsfördernde Stoffe, Antioxidantien, Lichtschutzmittel, Haftmittel zugefügt.
Als Lösungsmittel seien genannt: Wasser, Alkanole wie Ethanol, Isopropanol, 2-Hexyldecanol, Octyldodecanol und Tetrahydrofurfurylalkohol, Glykole wie Glycerol, Propylenglykol, Polyethylenglykole, Polypropylenglykole, aromatisch substituierte Alkohole wie Benzylalkohol, Phenylethanol, Phenoxyethanol, Ester wie Essigester, Butylacetat, Benzylbenzoat, Dibutyladipat, Dicaprylylcarbonat, Diethylhexylcarbonat, Propylencarbonat, Ether wie Dicaprylylether, Alkylenglykolalkylether wie Dipropylenglycolmonomethylether, Diethylenglykolmonoethylether, Ketone wie Aceton, Methylethylketon, Methylisobutylketon, aromatische und/oder aliphatische Kohlenwasserstoffe, pflanzliche oder synthetische fette Öle wie Erdnussöl, Olivenöl, Rapsöl, Sesamöl, Sojaöl, Sonnenblumenöl, Glycerylricinoleat, Mittelkettige Triglyceride, Propylenglykoldicaprylat/dicaprat, Propylenglykoldipelargonat und Propylenglykollaurat; andere Fettsäureester wie 2-Octyldodecylmyristat, Cetearylisononanoat, Cetearyloctanoat, Cetylethylhexanoat, Cococaprylat/caprat, Decylcocoat, Decyloleat, Ethyloleat, Isocetylpalmitat, Isopropylmyristat, Isopropylpalmitat, Isostearylisostearat, Octylpalmitat, Octylstearat, Oleylerucat; Silikonöle wie Cethyldimethicon, Dimethicon und Simethicon; Dimethylformamid, Dimethylacetamid, Glycerolformal, Glycofurol, 2-Pyrrolidon, N-Methylpyrrolidon, 2-Dimethyl-4-hydroxy-methylen-1,3-dioxolan, Dioctylcyclohexan.
Farbstoffe sind alle zur Anwendung am Tier zugelassenen Farbstoffe, die gelöst oder suspendiert sein können.
Resorptionsfördernde Stoffe sind z.B. DMSO, spreitende Öle wie Isopropylmyristat, Isopropylpalmitat, Dipropylenglykolpelargonat, Silikonöle, Fettsäureester, Triglyceride, Fettalkohole.
Antioxidantien sind Sulfite oder Metabisulfite wie Kaliummetabisulfat, Ascorbinsäure, Butylhydroxytoluol, Butylhydroxyanisol, Tocopherol.
Lichtschutzmittel sind z.B. Stoffe aus der Klasse der Benzophenone oder Novantisolsäure.
Haftmittel sind z.B. Cellulosederivate, Stärkederivate, Polyacrylate, natürliche Polymere wie Alginate, Gelatine.
Emulsionen sind entweder vom Typ Wasser in Öl oder vom Typ Öl in Wasser.
Sie werden hergestellt, indem man den Wirkstoff entweder in der hydrophoben oder in der hydrophilen Phase löst und diese unter Zuhilfenahme geeigneter Emulgatoren und gegebenenfalls weiterer Hilfsstoffe wie Farbstoffe, resorptionsfördernde Stoffe, Konservierungsstoffe, Antioxidantien, Lichtschutzmittel, viskositätserhöhende Stoffe, mit dem Lösungsmittel der anderen Phase homogenisiert.
Als hydrophobe Phase (Öle) seien genannt: Paraffinöle, Silikonöle, natürliche Pflanzenöle wie Sesamöl, Mandelöl, Rizinusöl, synthetische Triglyceride wie Capryl/Caprinsäure-triglycerid, Triglyceridgemisch mit Pflanzenfettsäure der Kettenlänge C8-12 oder anderen speziell ausgewählten natürlichen Fettsäuren, Partialglyceridgemische gesättigter oder ungesättigter eventuell auch hydroxylgruppenhaltiger Fettsäuren, Mono- und Diglyceride der C8/C10-Fettsäuren.
Fettsäureester wie Ethylstearat, Di-n-butyryl-adipat, Laurinsäurehexylester, Dipropylen-glykolpelargonat, Ester einer verzweigten Fettsäure mittlerer Kettenlänge mit gesättigten Fettalkoholen der Kettenlänge C16-C18, Isopropylmyristat, Isopropylpalmitat, Capryl/Caprinsäureester von gesättigten Fettalkoholen der Kettelänge C12-C18, Isopropylstearat, Ölsäureoleylester, Ölsäuredecylester, Ethyloleat, Milchsäureethylester, wachsartige Fettsäureester wie künstliches Entenbürzeldrüsenfett, Dibutylphthalat, Adipinsäurediisopropylester, letzterem verwandte Estergemische u.a.
Fettalkohole wie Isotridecylalkohol, 2-Octyldodecanol, Cetylstearyl-alkohol, Oleylalkohol.
Fettsäuren wie z.B. Ölsäure und ihre Gemische.
Als hydrophile Phase seien genannt:
Wasser, Alkohole wie z.B. Ethanol, Isopropanol, Propylenglykol, Glycerol, Sorbitol und ihre Gemische.
Als Emulgatoren seien genannt: nichtionogene Tenside, z.B. polyoxyethyliertes Rizinusöl, polyoxyethyliertes Sorbitan-monooleat, Sorbitanmonostearat, Glycerinmonostearat, Polyoxyethylstearat, Alkylphenolpolyglykolether;
ampholytische Tenside wie Di-Na-N-lauryl-β-iminodipropionat oder Lecithin;
anionaktive Tenside, wie Na-Laurylsulfat, Fettalkoholethersulfate, Mono/Dialkylpolyglykoletherorthophosphorsäureester-monoethanolaminsalz;
kationaktive Tenside wie Cetyltrimethylammoniumchlorid.
Als weitere Hilfsstoffe seien genannt: Viskositätserhöhende und die Emulsion stabilisierende Stoffe wie Carboxymethylcellulose, Methylcellulose und andere Cellulose- und Stärke-Derivate, Polyacrylate, Alginate, Gelatine, Gummi-arabicum, Polyvinylpyrrolidon, Polyvinylalkohol, Copolymere aus Methylvinylether und Maleinsäureanhydrid, Polyethylenglykole, Wachse, kolloidale Kieselsäure oder Gemische der aufgeführten Stoffe.
Suspensionen werden hergestellt, indem man den Wirkstoff in einer Trägerflüssigkeit gegebenenfalls unter Zusatz weiterer Hilfsstoffe wie Netzmittel, Farbstoffe, resorptionsfördernde Stoffe, Konservierungsstoffe, Stabilisatoren, Antioxidantien Lichtschutzmittel suspendiert.
Als Trägerflüssigkeiten seien alle homogenen Lösungsmittel und Lösungsmittelgemische genannt.
Als Netzmittel (Dispergiermittel) seien die weiter oben angegebene Tenside genannt.
Als weitere Hilfsstoffe seien die weiter oben angegebenen genannt.
Halbfeste Zubereitungen unterscheiden sich von den oben beschriebenen Suspensionen und Emulsionen nur durch ihre höhere Viskosität.
Die makrocyclischen Lactone können auch in Kombination mit Synergisten oder mit weiteren Wirkstoffen vorliegen. Bevorzugt ist die Kombination mit Insektiziden aus der Gruppe der Agonisten der nicotinergen Acetylcholinrezeptoren von Insekten, und zwar vorzugsweise mit Neonicotinoiden. Mit solchen Kombinationen lassen sich neben der Demodikose auch ektoparasitäre Insekten und Endoparasiten bekämpfen.
Unter Neonicotinoiden sollen insbesondere Verbindungen der Formel (I) verstanden werden: in welcher
R für Wasserstoff, gegebenenfalls substituierte Reste der Gruppe Acyl, Alkyl, Aryl, Aralkyl, Heteroaryl, Heteroarylalkyl oder Heterocyclylalkyl steht;
A für eine monofunktionelle Gruppe aus der Reihe Wasserstoff, Acyl, Alkyl, Aryl steht oder für eine bifunktionelle Gruppe steht, die mit dem Rest Z verknüpft ist;
E für einen elektronenziehenden Rest steht;
X für die Reste -CH= oder =N- steht, wobei der Rest -CH= anstelle eines H-Atoms mit dem Rest Z verknüpft sein kann;
Z für eine monofunktionelle Gruppe aus der Reihe Alkyl, -O-R, -S-R, wobei
R für gleiche oder verschiedene Reste steht und die oben angegebene Bedeutung hat,
oder Z für eine bifunktionelle Gruppe steht, die mit dem Rest A oder dem Rest X verknüpft ist.
Besonders bevorzugt sind Verbindungen der Formel (I), in welcher die Reste folgende Bedeutung haben:
R steht für Wasserstoff sowie für gegebenenfalls substituierte Reste aus der Reihe Acyl, Alkyl, Aryl, Aralkyl, Heteroaryl, Heteroarylalkyl, Heterocyclylalkyl.
Als Acylreste seien genannt Formyl, (C1-8-Alkyl)-carbonyl, (C6-10-Aryl)-carbonyl, (C1-8-Alkyl)-sulfonyl, (C6-10-Aryl)-sulfonyl, (C1-8-Alkyl)-(C6-10-Aryl)-phosphoryl, die ihrerseits substituiert sein können.
Als Alkyl seien genannt C1-10-Alkyl, insbesondere C1-4-Alkyl, im einzelnen Methyl, Ethyl, i-Propyl, sec.- oder t.-Butyl, die ihrerseits substituiert sein können.
Aryl ist insbesondere C6-10-Aryl, als Beispiele seien genannt Phenyl, Naphthyl, insbesondere Phenyl.
Aralkyl ist insbesondere (C6-10-Aryl)-(C1-4-Alkyl), als Beispiele seien genannt Phenylmethyl, Phenethyl.
Als Heteroaryl seien genannt Heteroaryl mit bis zu 10 Ringatomen und N, O, S insbesondere N als Heteroatomen. Im einzelnen seien genannt Thienyl, Furyl, Thiazolyl, Imidazolyl, Pyridyl, Benzthiazolyl.
Heteroarylalkyl ist insbesondere Heteroaryl-(C1-4-Alkyl), wobei Heteroaryl wie vorstehend definiert ist. Als Beispiele seien genannt Heteroarylmethyl, Heteroarylethyl mit bis zu 6 Ringatomen und N, O, S, insbesondere N als Heteroatomen.
Heterocyclyl ist insbesondere ein ungesättiger aber nicht aromatischer oder gesättigter Heterocyclus mit bis zu 6 Ringatomen, enthaltend bis zu 3 Heteroatome ausgewählt aus N, O, S, zum Beispiel Tetrahydrofuryl.
Heterocyclylalkyl ist insbesondere Heterocyclyl-C1-2-Alkyl, z.B.: Tetrahydrofuranylmethyl und Tetrahydrofuranylethyl.
Als Substituenten seien beispielhaft und vorzugsweise aufgeführt:
Alkyl mit vorzugsweise 1 bis 4, insbesondere 1 oder 2 Kohlenstoffatomen, wie Methyl, Ethyl, n- und i-Propyl und n-, i- und t-Butyl; Alkoxy mit vorzugsweise 1 bis 4, insbesondere 1 oder 2 Kohlenstoffatomen, wie Methoxy, Ethoxy, n- und i-Propyloxy und n-, i- und t-Butyloxy; Alkylthio mit vorzugsweise 1 bis 4, insbesondere 1 oder 2 Kohlenstoffatomen, wie Methylthio, Ethylthio, n- und i-Propylthio und n-, i- und t-Butylthio; Halogenalkyl mit vorzugsweise 1 bis 4, insbesondere 1 oder 2 Kohlenstoffatomen und vorzugsweise 1 bis 5, insbesondere 1 bis 3 Halogenatomen, wobei die Halogenatome gleich oder verschieden sind und als Halogenatome, vorzugsweise Fluor, Chlor oder Brom, insbesondere Fluor stehen, wie Trifluormethyl; Hydroxy; Halogen, vorzugsweise Fluor, Chlor, Brom und Jod, insbesondere Fluor, Chlor und Brom; Cyano; Nitro; Amino; Monoalkyl- und Dialkylamino mit vorzugsweise 1 bis 4, insbesondere 1 oder 2 Kohlenstoffatomen je Alkylgruppe, wie Methylamino, Methyl-ethyl-amino, n- und i-Propylamino und Methyl-n-butylamino; Carboxyl; Carbalkoxy mit vorzugsweise 2 bis 4, insbesondere 2 oder 3 Kohlenstoffatomen, wie Carbomethoxy und Carboethoxy; Sulfo (SO3H), Alkylsulfonyl mit vorzugsweise 1 bis 4, insbesondere 1 oder 2 Kohlenstoffatomen, wie Methylsulfonyl und Ethylsulfonyl; Arylsulfonyl mit vorzugsweise 6 oder 10 Arylkohlenstoffatomen, wie Phenylsulfonyl sowie Heteroarylamino und Heteroarylalkylamino wie Chlorpyridylamino und Chlorpyridylmethylamino.
A steht besonders bevorzugt für Wasserstoff sowie für gegebenenfalls substituierte Reste aus der Reihe Acyl, Alkyl, Aryl, die bevorzugt die bei R angegebenen Bedeutungen haben. A steht ferner für eine bifunktionelle Gruppe. Genannt sei gegebenenfalls substituiertes Alkylen mit 1-4, insbesondere 1-2 C-Atomen, wobei als Substituenten die weiter oben aufgezählten Substituenten genannt seien und wobei die Alkylengruppen durch Heteroatome aus der Reihe N, O, S unterbrochen sein können.
A und Z können gemeinsam mit den Atomen, an welche sie gebunden sind, einen gesättigten oder ungesättigten heterocyclischen Ring bilden. Der heterocyclische Ring kann weitere 1 oder 2 gleiche oder verschiedene Heteroatome und/oder Heterogruppen enthalten. Als Heteroatome stehen vorzugsweise Sauerstoff, Schwefel oder Stickstoff und als Heterogruppen N-Alkyl, wobei Alkyl der N-Alkyl-Gruppe vorzugsweise 1 bis 4, insbesondere 1 oder 2 Kohlenstoffatome enthält. Als Alkyl seien Methyl, Ethyl, n- und i-Propyl und n-, i- und t-Butyl genannt. Der heterocyclische Ring enthält 5 bis 7, vorzugsweise 5 oder 6 Ringglieder.
Als Beispiele für den heterocyclischen Ring seien Pyrrolidin, Piperidin, Piperazin, Hexamethylenimin, Hexahydro-1,3,5-triazin, Morpholin und Oxadiazin genannt, die gegebenenfalls bevorzugt durch Methyl substituiert sein können.
E steht für einen elektronentziehenden Rest, wobei insbesondere NO2, CN, Halogenalkylcarbonyl wie Halogen-C1-4-alkylcarbonyl mit 1 bis 9 Halogenatomen, insbesondere COCF3, sowie C1-4-Alkylsulfonyl und Halogen-C1-4-alkylsulfonyl mit 1 bis 9 Halogenatomen, insbesondere SO2CF3, genannt seien.
X steht für -CH= oder -N=
Z steht für gegebenenfalls substituierte Reste Alkyl, -OR, -SR, -NRR, wobei R und die Substituenten bevorzugt die oben angegebene Bedeutung haben.
Z kann außer dem obengenannten Ring gemeinsam mit dem Atom, an welches es gebunden ist und dem Rest an der Stelle von X einen gesättigten oder ungesättigten heterocyclischen Ring bilden. Der heterocyclische Ring kann weitere 1 oder 2 gleiche oder verschiedene Heteroatome und/oder Heterogruppen enthalten. Als Heteroatome stehen vorzugsweise Sauerstoff, Schwefel oder Stickstoff und als Heterogruppen N-Alkyl, wobei die Alkyl oder N-Alkyl-Gruppe vorzugsweise l bis 4, insbesondere 1 oder 2 Kohlenstoffatome enthält. Als Alkyl seien Methyl, Ethyl, n- und i-Propyl und n-, i- und t-Butyl genannt. Der heterocyclische Ring enthält 5 bis 7, vorzugsweise 5 oder 6 Ringglieder.
Als Beispiele für den heterocyclischen Ring seien Pyrrolidin, Piperidin, Piperazin, Hexamethylenimin, Morpholin und N-Methylpiperazin genannt.
Als ganz besonders bevorzugt erfindungsgemäß verwendbare Verbindungen seien Verbindungen der allgemeinen Formeln (II), (III) und (IV) genannt: in welchen
n für 1 oder 2 steht,
m für 0, 1 oder 2 steht,
Subst. für einen der oben aufgeführten Substituenten, insbesonders für Halogen, ganz besonders für Chlor, steht,
A, Z, X und E die oben angegebenen Bedeutungen haben.
Im einzelnen seien folgende Verbindungen genannt:
Im einzelnen seien folgende besonders bevorzugte Verbindungen genannt:
Neben nicotinischen Agonisten aus der Gruppe der Neonicotinoide können erfindungsgemäß auch andere nicotinische Agonisten eingesetzt werden.
Anwendungsfertige Zubereitungen der erfindungsgemäß verwendbaren Mittel enthalten üblicherweise die Wirkstoffe jeweils in Konzentrationen von 10 ppm bis 30% m/m; das makrocyclische Lacton wird bevorzugt in Konzentrationen von 0,01 bis 15% m/m, besonders bevorzugt 0,02 bis 10% m/m eingesetzt; das Neonicotinoid wird bevorzugt in Konzentrationen von 1 bis 20% m/m, besonders bevorzugt 5-15% m/m eingesetzt.
Zubereitungen die vor Anwendung verdünnt werden, enthalten die Wirkstoffe in entsprechend höheren Konzentrationen, z. B. 0,5 bis 90% m/m, vorzugsweise 5 bis 50% m/m.
Im Allgemeinen hat es sich als vorteilhaft erwiesen, Mengen von etwa 0,01 bis 100 mg Wirkstoff je kg Körpergewicht pro Tag zur Erzielung wirksamer Ergebnisse zu verabreichen, bevorzugte übliche Tagesdosen liegen beim makrocyclischen Lacton im Bereich von 0,05 bis 10 mg/kg, besonders bevorzugt 0,1 bis 8 mg/kg; falls ein Neonicotinoid eingesetzt wird, liegen übliche Tagesdosen bevorzugt im Bereich 1 bis 20 mg/kg, besonders bevorzugt bei 5-10 mg/kg.
Erfindungsgemäß besonders bevorzugt sind pour-on- oder spot-on-Formulierungen. Diese werden in vergleichsweise kleinen Mengen von üblicherweise 0.1 bis 20 ml, vorzugsweise 0.4 bis 10 ml auf einen kleinen Teil der Körperoberfläche des zu behandelnden Tieres aufgebracht.
Solche Formulierungen enthalten das makrocyclische Lacton in Mengen von 0,01 bis 10% m/m, bevorzugt 0,02 bis 8% m/m.
Der Gehalt an Neonicotinoid – sofern dieses eingesetzt wird – liegt üblicherweise bei 1-20% m/m, bevorzugt bei 5-15% m/m.
Als Lösungsmittel für die pour-on oder spot-on Formulierungen eignen sich die oben genannten Lösungsmittel.
Bevorzugt sind hierbei Lösungsmittel, die über sehr gute Lösungseigenschaften für makrocylische Laktone verfügen wie Ethanol, Isopropanol, Propylenglykol, 2-Hexyldecanol, Octyldodecanol, Dibutyladipat, Mittelkettige Triglyceride, Propylenglykoldicaprylat/dicaprat, Propylenglykollaurat, Isopropylmyristat, Isopropylpalmitat, Propylencarbonat, Dipropylenglycolmonomethylether, Diethylenglykolmonoethylether und Ketone.
Bevorzugt sind auch Lösungsmittel, die über gute Spreiteigenschaften verfügen, wie 2-Hexyldecanol, Octyldodecanol, 2-Octyldodecylmyristat, Cetearylisononanoat, Cetearyloctanoat, Cetylethylhexanoat, Coco-caprylat/caprat, Decylcocoat, Decyloleat, Ethyloleat, Isocetylpalmitat, Isopropylmyristat, Isopropylpalmitat, Isostearylisostearat, Octylpalmitat, Octylstearat, Oleylerucat, Mittelkettige Triglyceride, Propylenglykoldicaprylat/dicaprat, Dipropylenglycolmonomethylether, Diethylenglykolmonoethylether, Cetyldimethicon, Dimethicon und Simethicon.
Besonders bevorzugt sind hierbei Lösungsmittel, die über gute Löseeigenschaften für makrocylische Laktone und über gute Spreiteigenschaften verfügen, wie 2-Hexyldecanol, Octyldodecanol, Dibutyladipat, Dipropylenglycolmonomethylether, Diethylenglykolmonoethylether, Mittelkettige Triglyceride, Propylenglykoldicaprylat/dicaprat, Propylenglykollaurat, Isopropylmyristat und Isopropylpalmitat.
Die Lösungsmittel können alleine oder auch in Kombination eingesetzt werden. Ihre Gesamtkonzentration liegt üblicherweise zwischen 10 und 98% m/m, bevorzugt zwischen 30 und 95% m/m.
Die bevorzugten Spot-on- oder Pour-on-Formulierungen können darüber hinaus übliche pharmazeutische Zusatz- und Hilfsmittel enthalten.
Spot-on- oder Pour-on-Formulierungen können auch als Emulsionskonzentrate formuliert werden. Hierbei sind die Wirkstoffe in erhöhter Konzentration in einem Lösungsmittel zusammen mit einem Dispergierhilfsmittel gelöst. Der Anwender gibt eine bestimmte Menge dieses Konzentrates in Wasser, worauf sich spontan oder nach Umschütteln eine Emulsion bildet. Als Lösungsmittel können die oben genannten Stoffe und als Dispergierhilfsmittel die ebenfalls oben genannten ionogenen und nicht-ionogenen Emulgatoren eingesetzt werden.
Falls die makrocyclischen Lactone in Kombination mit anderen Wirkstoffen angewendet werden bedeutet dies entweder, dass die makrocyclischen Lactone und der oder die weiteren Wirkstoffe getrennt oder zeitlich abgestuft angewendet werden können. In diesem Fall sind die makrocyclischen Lactone und die weiterhin eingesetzten Wirkstoffe jeweils als gesonderte Arzneimittel formuliert. Ebenfalls möglich ist die gleichzeitige Anwendung; erfindungsgemäß ist es bevorzugt, dass makrocycliches Lacton und weiterer Wirkstoff gemeinsam in einem Mittel formuliert sind.
Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform können die in WO 00/30449 beschriebenen Formulierungen verwendet werden, auf dieses Dokument wird hiermit ausdrücklich Bezug genommen. Die dort beschriebenen Formulierungen eignen sich insbesondere zur Spot-on Applikation. Diese Formulierungen enthalten:
- (a) 0,1 bis 50% w/v, bevorzugt 1 bis 16% w/v, besonders bevorzugt 4 bis 12% w/v, ganz besonders bevorzugt 6 bis 12% w/v eines makrocyclischen Lactons
- (b) 1 bis 50% v/v, bevorzugt bis zu 20% v/v, besonders bevorzugt 2 bis 16% v/v, ganz besonders bevorzugt 4 bis 12% v/v, insbesondere 6 bis 12% v/v eines Di-(C2-4-Glycol)mono(C1-4-alkyl)ethers
- (c) gegebenenfalls ein Antioxidans
- (d) gegebenenfalls ein hautverträgliches flüchtiges Lösungsmittel q.s. v/v
Die Formulierung eignet sich für die weiter oben näher beschriebenen makrocyclischen Lactone, insbesondere für Selamectin.
Bei dem Di-(C2-4-Glycol)mono(C1-4-alkyl)ether handelt es sich bevorzugt um Diethylenglycolmonomethylether oder insbesondere Dipropylenglycolmonomethylether.
Bevorzugt enthält die Formulierung das hautverträgliche flüchtige Lösungsmittel, bevorzugte Beispiele sind Ethanol und insbesondere Isopropanol.
Als Antioxidans kommen beispielsweise Propylgallat, BHA (2-tert.-Butyl-4-methoxyphenol) oder insbesondere BHT (2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol) in Frage. Üblicherweise ist das Antioxidans in Konzentrationen von 0,2% w/v oder weniger, bevorzugt 0,1% w/v oder weniger, in den Formulierungen enthalten.
Gemäß einer besonders bevorzugten weiteren Ausführungsform eignet sich die folgende Basis für erfindungsgemäß einsetzbare Formulierungen, insbesondere spot-on Formulierungen:
Als Lösungsmittel A wird Benzylalkohol oder ein gegebenenfalls substituiertes Pyrrolidon, eingesetzt. Gegebenenfalls substituierte Pyrrolidone sind z. B. 2-Pyrrolidon; 1-(C1-C10)-Pyrrolidon-2 wie 1-Methylpyrrolidon, 1-Ethylpyrrolidon, 1-Octylpyrrolidon, 1-Dodecylpyrrolidon, 1-Isopropylpyrrolidon, 1-(n-, sek.- oder tert.-Butyl)-Pyrrolidon, 1-Hexylpyrrolidon; 1(C2-C10-Alkenyl)-pyrrolidon-2 wie 1-Vinylpyrrolidon-2; 1-(C3-C8-Cycloalkyl)-pyrrolidon-2 wie 1-Cyclohexylpyrrolidon; 1-(3-Hydroxypropyl)-pyrrolidon, l-(2-Methoxyethyl)-pyrrolidon, 1-(3-Methoxyproypl)-pyrrolidon, 1-Benzylpyrrolidon. Von diesen besonders bevorzugt ist Benzylalkohol.
Bevorzugt ist die Verwendung des Lösungsmittels A als Gemisch mit einem Co-Lösungsmittel B ausgewählt aus der Gruppe der cyclischen Carbonate und Lactone (bevorzugte Beispiele sind γ-Butyrolacton, Ethylencarbonat und insbesondere Propylencarbonat) wobei Lösungsmittel A einen Anteil von 20 bis 99% m/m, bevorzugt 40 bis 90% m/m, besonders bevorzugt 50 bis 90% m/m und Lösungsmittel B entsprechend 1 bis 80% m/m, bevorzugt 10 bis 60% m/m, besonders bevorzugt 10 bis 50% m/m hat.
In dem Lösungsmittel oder Lösungsmittelgemisch sind der oder die Wirkstoffe sowie gegebenenfalls weitere Hilfs- und Zusatzstoffe gelöst.
Formulierungen dieser Art eignen sich beispielsweise besonders für Ivermectin oder Moxidectin gegebenenfalls in Kombination mit einem Neonicotinoid wie Imidacloprid.
Die erfindungsgemäße topische Behandlung der Demodikose mit makrocyclischen Lactonen ermöglicht eine einfache und bequeme aber dennoch effektive Behandlung der Krankheit. Üblicherweise genügen Applikationen im Abstand von mindestens einer Woche, bevorzugt mindestens zwei Wochen, besonders bevorzugt mindesten drei Wochen, insbesondere alle vier Wochen um gute Behandlungserfolge zu erzielen. Die Behandlung dauert in der Regel 2 bis 4 Monate.
Die folgenden Beispiele für erfindungsgemäß verwendbare Formulierungen erläutern die Erfindung ohne sie in irgendeiner Weise zu begrenzen:
100 ml Formulierung enthalten:
100 ml Formulierung enthalten:
Biologisches Beispiel Feldstudie: Behandlung der Demodikose bei Hunden
Bei 23 Hunden wurde eine generalisierte Demodikose mit Advocate ® spot-on (100 mg Imidacloprid und 25 mg Moxidectin pro ml) behandelt. Das Mittel wurde am Tag 0 und 28 jeweils ein Mal für 4 Wochen appliziert, Hunde bei denen sich am Tag 28 oder 56 noch Demodex-Milben nachweisen ließen wurden ein drittes Mal behandelt, Hunde bei denen am Tag 56 oder 84 noch Demodex-Milben nachgewiesen werden konnten wurden ein viertes Mai behandelt.
87% der Hunde waren am Ende der Behandlung milbenfrei, bei den übrigen Hunden konnten deutliche Verbesserungen des Krankheitsbildes festgestellt werden.
Als Vergleich wurde in dieser Studie das Produkt Interceptor ® (Tabletten enthaltend Milbemycinoxim) getestet. Diese Tabletten wurden täglich oral über 2 bis 4 Monate verabreicht. Die Ergebnisse bei der Demodikose-Behandlung waren denen mit Advocate ® vergleichbar, allerdings ist die spot-on Applikation einmal in 4 Wochen von Advocate ® deutlich einfacher und bequemer als die tägliche Tablettengabe bei Interceptor ® .
Canine Demodikose
Die canine Demodikose ist eine häufige, durch die übermäßige Vermehrung der Haarbalgmilbe Demodex canis hervorgerufene, parasitäre Hauterkrankung der Hunde (Canidae). Sie kann örtlich begrenzt oder am ganzen Körper auftreten. Die Demodikose entsteht bei älteren Tieren nur im Zusammenhang mit Störungen des Immunsystems, bei Jungtieren ist die Entstehung der Krankheit nicht vollständig aufgeklärt. Die Demodikose beginnt zumeist mit Haarausfall und ohne Juckreiz. Im weiteren Verlauf können sich durch eine bakterielle Sekundärinfektion stärkere Hautveränderungen bis zu einer eitrigen Hautentzündung (Pyodermie) entwickeln. Die Krankheit wird durch den mikroskopischen Nachweis der Milben festgestellt. Die Behandlung erfolgt mit milbenwirksamen Medikamenten.
Krankheitsursache
Auslöser einer Demodikose ist vor allem Demodex canis. Demodex canis ist eine schlanke, etwa 250 bis 300 µm lange und 40 µm dicke Milbe, die in den Haarbälgen (Haarfollikeln) und Talgdrüsen parasitiert. Dort ernährt sie sich von Talg, Gewebsflüssigkeit und den natürlich abgestoßenen Zellen. In geringer Zahl kommen diese Milben als Kommensale auch bei vielen klinisch gesunden Tieren vor. Die weiblichen Milben legen Eier, die sich über ein Larven- und Nymphenstadium zu den erwachsenen Milben entwickeln. Der gesamte Entwicklungszyklus findet in den Haarbälgen statt und dauert 20 bis 35 Tage. Außerhalb des Wirtes sind Haarbalgmilben nicht überlebensfähig und sterben infolge Austrocknung schnell ab. Haarbalgmilben produzieren keinen Kot, sondern lagern Stoffwechselabbauprodukte in Zellen des Darmtrakts ein, so dass sie kaum eine Immunantwort provozieren.
In jüngerer Zeit wurden weitere Demodex-canis-ähnliche Milben beschrieben, die größer bzw. kleiner sind. Die kürzere Milbe wurde Demodex cornei, die längere Demodex injai genannt. Demodex cornei lebt vor allem auf der Hautoberfläche und kann in Kombination mit Demodex canis auftreten. Demodex injai scheint sich vor allem in den Talgdrüsen aufzuhalten.
Krankheitsentstehung und Verbreitung
Die Übertragung der Demodex-Milben erfolgt zumeist schon im Alter von wenigen Lebenstagen von der Hündin auf die Welpen beim Säugen. Diese Infektion bleibt aber in der Regel symptomlos. Eine Übertragung von Hund zu Hund nach dem dritten Lebenstag gilt als unwahrscheinlich. Zum Ausbruch einer Demodikose kommt es erst viel später, wenn sich diese Milben stark vermehren. Betroffene Jungtiere scheinen keine Störungen des Immunsystems zu haben. Lediglich eine vorübergehende Verminderung der T-Zell-Immunität wird beobachtet, die unter Umständen aber nur Folge der Erkrankung ist. Bei älteren Tieren kommt es meist durch Störungen des Immunsystems (Tumore, Nebennierenüberfunktion, Schilddrüsenunterfunktion, Leishmaniose, Mangelernährung sowie Behandlung mit Glukokortikoiden, anderen Immunsuppressiva, Progesteron oder Chemotherapeutika) zu einer Demodikose.
Der Erreger verursacht bei Krankheitsausbruch eine Schädigung der beim Hund zusammengesetzten Haarfollikel (bis zu 20 Haare pro Follikel) und eine Störung der Haarbildung.
Die Demodikose tritt weltweit auf. Eine erhöhte Krankheitsneigung bestimmter Hunderassen (Rasseprädisposition) wird in Europa, im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten, nicht beobachtet. In Amerika sind vor allem Englische Bulldogge, Französische Bulldogge, Mops, Dobermann, Deutscher Schäferhund und einige Terrier betroffen. Dies wird dadurch erklärt, dass in Europa immungeschwächte Tiere („Kümmerer“) nicht zur Zucht verwendet werden. Darüber hinaus scheint es eine individuelle genetische Prädisposition zu geben.
Eine Übertragung auf andere Spezies findet nicht statt, da Haarbalgmilben streng wirtsspezifisch sind.
Klinisches Bild
Demodex-canis-Infektionen
Das erste Zeichen einer Demodikose durch Demodex canis ist zumeist Haarausfall (Alopezie), der nur an umschriebenen Stellen oder auch am ganzen Körper (generalisiert) auftreten kann. Häufig tritt an den haarlosen Stellen eine vermehrte Talg- (Seborrhö) oder Schuppenbildung auf. In einigen Fällen können letztere Symptome auch ohne Haarverlust auftreten. Später kann es zu einer grauen Verfärbung der geschädigten Areale kommen. Bis zu diesem Stadium ist zumeist kein Juckreiz vorhanden.
Bei Jungtieren (jünger als 18 Monate) beginnen die Veränderungen zumeist im Gesichtsbereich („Brillenbildung“, Lefzen, Kinn) und/oder an den Gliedmaßen. Zumeist heilt diese Erkrankung auch ohne Behandlung nach wenigen Wochen ab, sie kann sich aber auch weiter ausdehnen und in eine generalisierte Demodikose übergehen.
Im weiteren Verlauf ist das klinische Bild durch eine bakterielle Sekundärinfektion, vor allem mit Staphylokokken, seltener auch mit Proteus, Klebsiellen oder Escherichia coli gekennzeichnet. Es kommt zu einer Follikulitis, Furunkulose und übermäßigen Verhornung (Hyperkeratose). Gelegentlich kann sich dieses Stadium der Erkrankung auch durch Pusteln manifestieren. Bei tiefem Eindringen der Bakterien in die Haut entwickelt sich eine eitrige Hautentzündung (Pyodermie) mit Bildung von Krusten und Schwellungen der Lymphknoten. Hier ist bei jungen Hunden differentialdiagnostisch eine Canine juvenile Zellulitis auszuschließen.
Sonderformen sind der Befall der Haut der Füße und des Ohrs. Der Befall der Füße (Pododemodikose) äußert sich in Rötung und Schwellung (Ödem) im Zwischenzehenbereich; in ausgeprägten Fällen entwickeln sich Granulome und Fisteln, so dass das Bild einer chronischen Pododermatitis entsteht. Der Befall des äußeren Gehörgangs (Otodemodikose) wird vor allem bei generalisierter Demodikose beobachtet und ist durch ein bräunliches Sekret gekennzeichnet.
Infektionen mit anderen Demodex-Milben
Demodex-injai-Infektionen äußern sich zumeist mit erhöhter Talgproduktion („fettige Haut“), schlechter Haarqualität mit schütterem Haar und vor allem am Rücken auftretendem Juckreiz. Auch Papeln, Pusteln oder „Mitesser“ können auftreten. Diese Form der Demodikose wird vor allem bei Terriern beobachtet. Demodex-cornei-Infektionen zeigen sich in Rötungen der Haut, Schuppenbildung und ausgeprägtem Juckreiz.
Untersuchungsmethoden
Die Diagnose erfolgt durch Nachweis lebender Milben in den Haarfollikeln. Dazu muss in der Regel ein tiefes Hautgeschabsel entnommen werden. Auch mit Herausziehen eines Haarbüschels („hair pluck“), dem Ausquetschen der Haarfollikel bzw. Talgdrüsen mit einer Klemme oder einer Hautbiopsie kann Probenmaterial für die anschließende mikroskopische Untersuchung gewonnen werden. Hautbiopsien sind vor allem bei Pododemodikose mit Granulombildung sowie Rassen mit sehr dicker Haut (Englische Bulldogge, Shar-Pei) sinnvoll, da ein Hautgeschabsel von ausreichender Tiefe hier selten gelingt. Insgesamt ist die Zahl nachgewiesener Milben im Hautgeschabsel größer als mit den anderen Methoden.
Vor allem bei Therapiekontrollen (siehe unten) dürfen keine Aufhellungspräparate mit Kaliumhydroxid angefertigt werden, da dann die Einschätzung der Vitalität der Milben nicht möglich ist. Die Proben sollten daher nur in einen auf einen Objektträger aufgebrachten Tropfen Paraffinöl eingebettet werden. Empfehlenswert ist es, das Präparat vor der Untersuchung etwa 10 Minuten liegen zu lassen, weil die Haarbalgmilben dann aus den Wurzelscheiden der Haare auswandern und somit besser sichtbar sind. Zu beachten ist, dass einzelne Haarbalgmilben einen physiologischen Befund darstellen können, also nur eine deutliche Ansammlung mit Vorhandensein von Eiern, Larven und Nymphen in Zusammenhang mit dem klinischen Bild als eindeutige Diagnose gilt.
Bei stärkerem Befall können Milben auch über die Lymphgefäße in regionäre Lymphknoten gelangen oder durch orale Aufnahme beim Belecken auch im Kot nachgewiesen werden.
Bei bakterieller Sekundärinfektion wird der Erregernachweis durch bakteriologische Untersuchung und die Anfertigung eines Antibiogramms empfohlen.
Behandlung
Eine lokale Demodikose bei Jungtieren bildet sich in 90 % der Fälle wieder spontan zurück. Ob eine Behandlung sinnvoll ist oder nicht, ist in der Literatur umstritten. Zum einen wird sie empfohlen, um eine Generalisierung zu vermeiden, zum anderen wird empfohlen, gerade die mögliche Generalisierung abzuwarten, um sie als Zuchtausschlusskriterium (siehe unten) nutzen zu können. Eine lokale äußerliche (topische) Behandlung zum Beispiel durch Auftragen eines Gels mit Benzoylperoxid, Chlorhexidin oder Rotenon ist dabei zumeist ausreichend. Benzoylperoxid dringt zwar gut in die Haarfollikel ein, wirkt allerdings stark austrocknend und zum Teil hautreizend. Eine ausgeprägte Demodikose ist generell mit einer Ganzkörperbehandlung zu therapieren.
Sowohl bei lokaler als auch systemischer Demodikose hat sich die regelmäßige Waschbehandlung mit Amitraz bewährt. Einige Zwerghunderassen (Chihuahua, Malteser) reagieren allerdings sehr empfindlich auf diesen Wirkstoff, so dass der Einsatz bei diesen nicht empfohlen wird. Bei starkem Befall wird bei langhaarigen Hunden eine vollständige Schur empfohlen, da der Wirkstoff die Haut gut benetzen muss, um tief genug in die Haarbälge eindringen zu können. Bei starker bakterieller Sekundärinfektion ist zunächst diese zu behandeln, z. B. durch Scheren der betroffenen Partien, Reinigen mit desinfizierend wirkenden Waschlösungen und systemischer Verabreichung von Antibiotika, da Amitraz nicht auf größere Wunden aufgebracht werden sollte. Seit Juni 2009 ist auch ein Spot-on-Präparat mit Amitraz zur Behandlung der Demodikose zugelassen, das nur 14-täglich aufgetragen werden muss. Insbesondere bei lokaler Demodikose ist eine 14-tägliche Therapiekontrolle sinnvoll, um einem zu frühen Abbruch der Behandlung und damit der Gefahr der Entstehung einer generalisierten Demodikose vorzubeugen. Ein sich abzeichnender Behandlungserfolg ist anhand der Abnahme der Zahl lebender Milben, der Zunahme verkrüppelter Milben und der Abnahme der Larven sichtbar. Eine vollständige Ausheilung wird durch nachgewachsene Haare und fehlenden Nachweis lebender Milben angezeigt und gelingt mit Amitraz etwa in 80 % der Fälle. In etwa 40 % der Fälle treten Nebenwirkungen wie Abgeschlagenheit und Juckreiz auf, die durch stärkere Verdünnung oder Verminderung der Behandlungsfrequenz reduziert werden können. Gelegentlich können auch schwerere Nebenwirkungen wie Fressunlust, Ataxie sowie vermehrter Durst und Harnabsatz auftreten. Da Amitraz auch zu einem Anstieg des Blutzuckerspiegels führt, ist der Einsatz bei zuckerkranken Hunden kontraindiziert.
Die systemische Behandlung mit Ivermectin, Moxidectin oder Milbemycinoxim ist ebenfalls gut wirksam und wird vor allem bei Therapieversagern mit Amitraz eingesetzt. Diese Wirkstoffe werden täglich peroral bis zur erfolgreichen Therapiekontrolle (s. u.) verabreicht. Zu beachten ist, dass einige Hunderassen und Welpen unter 12 Wochen aufgrund der insuffizienten Blut-Hirn-Schranke sehr empfindlich auf einige Avermectine reagieren (→ MDR1-Defekt) und es in Deutschland mit Moxidectin nur ein einziges für Hunde zugelassenes Avermectin-Präparat gibt. Die Behandlung mit Milbemycinoxim ist auch bei Avermectin-empfindlichen Hunden möglich. Sie muss aber im Regelfall über etwa 70 Tage durchgeführt werden und ist daher sehr kostenintensiv. Aktuelle Studien zeigen bei generalisierter Demodikose eine gute Wirksamkeit von Isoxazolinen wie Fluralaner oder Afoxolaner.
Aufgrund deutlicher Nebenwirkungen und der Gefahr von Vergiftungen werden Akarizide auf der Basis organischer Phosphorsäureester heute kaum noch angewendet.
Unterstützend kann Vitamin E verabreicht werden. Tritt eine Demodikose bei Hündinnen im Zusammenhang mit der Läufigkeit zyklisch auf, ist eine Kastration zu erwägen. Eine Behandlung mit Glukokortikoiden oder Progesteron ist bei Demodikose kontraindiziert.
Bei bakterieller Sekundärinfektion ist zusätzlich zur Milbenbekämpfung eine lokale Behandlung mit desinfizierenden Lösungen (Benzoylperoxid, Chlorhexidin, Povidon-Iod) oder Antibiotika, bei schweren Pyodermien auch die systemische Verabreichung von Antibiotika vor der eigentlichen Milbenbekämpfung angezeigt.
Behandlungsaussicht
Die Behandlung ist bei lokalisierter Demodikose zumeist erfolgreich. Von einer erfolgreichen Therapie wird ausgegangen, wenn sich in zwei, im Abstand von zwei Wochen aufeinanderfolgenden Hautuntersuchungen von vier bis fünf verschiedenen Stellen keine lebenden Milben mehr nachweisen lassen. Schwere, generalisierte Formen und die Pododemodikose können sich als therapieresistent erweisen, insbesondere wenn nicht behebbare Störungen des Immunsystems oder fördernde Primärleiden vorliegen. Die Gefahr von Rezidiven sinkt deutlich, wenn das betroffene Tier ein Jahr symptomfrei bleibt. Bei einigen Tieren kann eine Symptomfreiheit nur durch lebenslange Gabe von Amitraz oder Ivermectin erreicht werden.
Die American Academy of Veterinary Dermatology empfiehlt bei einer generalisierten Demodikose eines Jungtieres oder rezidivierenden Demodikosen den Ausschluss des betroffenen Tieres sowie seiner Eltern und Geschwister von der Zucht.
Parasites & Vectors
Table of Contents
Efficacy of orally administered fluralaner (Bravecto TM ) or topically applied imidacloprid/moxidectin (Advocate®) against generalized demodicosis in dogs
- Josephus J Fourie 1Email author ,
- Julian E Liebenberg 1 ,
- Ivan G Horak 2 ,
- Janina Taenzler 3 ,
- Anja R Heckeroth 3 and
- Regis Frénais 4
© Fourie et al.; licensee BioMed Central. 2015
Received: 22 December 2014
Accepted: 26 February 2015
Background
This laboratory study compared the efficacy of Bravecto™ (fluralaner), formulated as a chewable tablet, with the efficacy of Advocate® (imidacloprid/moxidectin), formulated for topical administration, against naturally acquired generalized demodicosis in dogs.
Sixteen dogs, all diagnosed with generalized demodectic mange, were randomly allocated to two equal groups. Bravecto™ chewable tablets were administered once orally at a minimum dose of 25 mg fluralaner/kg body weight to one group of dogs, while the second group was treated topically on three occasions at 28-day intervals with Advocate® at a minimum dose of 10 mg imidacloprid/kg body weight and 2.5 mg moxidectin/kg body weight. Mites were counted in skin scrapings and demodectic lesions were evaluated on each dog before treatment and at 28-day intervals thereafter over a 12 week study period. Deep skin scrapings (
4 cm 2 ) were made from the same five sites on each dog at each subsequent examination.
After single oral administration of Bravecto™ chewable tablets, mite numbers in skin scrapings were reduced by 99.8% on Day 28 and by 100% on Days 56 and 84. Mite numbers in the dogs treated topically on three occasions at 28-day intervals with Advocate® were reduced by 98.0% on Day 28, by 96.5% on Day 56 and by 94.7% on Day 84. Statistically significantly (P ≤ 0.05) fewer mites were found on Days 56 and 84 on the Bravecto™ treated dogs compared to Advocate® treated dogs. A marked decrease was observed in the occurrence of erythematous patches, crusts, casts and scales in the dogs treated with Bravecto™ and in the occurrence of erythematous patches in the dogs treated with Advocate®. With the exception of one dog in each treated group, all dogs exhibited hair regrowth ≥ 90% at the end of the study in comparison with their hair-coat at study start.
Conclusions
Single oral administration of Bravecto™ chewable tablets is highly effective against generalized demodicosis, with no mites detectable at 56 and 84 days following treatment. In comparison, Advocate®, administered three times at 28-day intervals, is also highly effective against generalized demodicosis, but most dogs still harboured mites at all assessment time points. Both treatments resulted in a marked reduction of skin lesions and increase of hair re-growth 12 weeks after the initial treatment.
Background
Historically the only follicular mite considered to infest dogs is Demodex canis [ 1 ], but two other mites have subsequently been described. Desch and Hillier [ 2 ] described Demodex injai, a mite that is considerably longer than D. canis, while Tamura et al. [ 3 ] described a mite that is considerably shorter than D. canis, but failed to name it. In the literature this mite is now usually referred to as Demodex cornei. The three species differ in length as described by Izdebska and Fryderyk [ 4 ] with reference to average values. For D. canis adult female mites measured 226.0 μm and the males 195.2 μm. Adult female D. injai measured 330.9 μm and the males 371.8 μm. For D. cornei adult female mites measured 139.4 μm and the males 120.8 μm. Various molecular studies have been carried out to determine the specific identities of the three mites. Based on the results obtained from the mitochondrial markers 16S rDNA and Cytochrome Oxidase I (COI) for the three morphotypes of D. canis, De Rojas et al. [ 5 ] concluded that they are polymorphs of the same species. On the other hand phylogenetic analysis of the three species, based on partial sequences of mitochondrial 16S rDNA, led Sastre et al. [ 6 ] to propose that D. canis and D. injai are valid separate species and D. cornei a morphological variant of D. canis. A year later similar analyses performed by Milosevic et al. [ 7 ] confirmed that D. injai is a valid species. It is clear that further studies are required to ascertain the specific status of the mite referred to as D. cornei.
Demodex spp. mites (D. canis, D. injai, and D. cornei) are normal commensals of the dog’s skin parasitising within the sebaceous glands connected to the hair follicles. Should their numbers increase dramatically, they are capable of producing a disease known as canine demodicosis or demodectic mange. Canine demodicosis is an inflammatory parasitic skin disease that can be classified as localized or generalized according to the extent of the lesions. Localized demodicosis occurs as only small areas of alopecia, most commonly on the face and the forelegs. It is a benign disease and most cases resolve spontaneously within six to eight weeks. Demodicosis is considered generalized when five or more areas on the body are affected, or pododemodicosis is observed on two or more feet, or when an entire body region is involved [ 8 , 9 ]. Demodicosis can also be categorized as either juvenile (dogs up to 18 months of age), adult onset (dogs generally older than four years of age with no previous history of disease), or chronic generalized (persisting disease for at least six months) [ 10 , 11 ]. Susceptibility of dogs to infestations with Demodex spp. and to progression of the clinical disease are influenced by numerous factors including (listed in decreasing order of importance): immune status which may be affected by debilitating diseases, endoparasitism, breed, age as well as nutritional or hormonal status, other immunological disorders such as genetic defects and alteration of the skin’s biochemistry and structure [ 12 ]. Although D. canis remains the most common species/morphotype encountered in demodicosis, moderate alopecia, and greasy seborrhoeic dermatitis along the dorsal trunk of dogs has been associated with increased numbers of D. injai [ 13 ]. Moreover, bilateral ceruminous otitis in a beagle, of which D. injai was the cause, has been described [ 7 ]. D. cornei would appear to be an inhabitant of the host’s stratum corneum [ 5 ], and Shipstone [ 11 ] mentions that D. cornei has been found in association with a generalised, pruritic, scaly dermatitis, with the mites present in the surface scale.
Chronic generalized demodicosis is a frustrating and difficult skin disease to treat [ 14 - 16 ]. In dogs that are otherwise healthy, the generalized form of the disease is unlikely to resolve without therapy [ 10 ]. Therapeutic options that are currently available include amitraz, ivermectin, milbemycin oxime and moxidectin, mostly to be given at multiple occasions for periods of three months or more [ 16 - 18 ]. To be effective, these treatment regimens require high owner compliance over an extended period of time.
The active ingredient of Bravecto™, fluralaner, is a novel, long-acting systemic insecticide and acaricide belonging to the isoxazoline class of parasiticides with selective inhibition of arthropod γ–aminobutyric acid- and L–glutamate-gated chloride channels [ 19 ]. In field studies involving naturally infested dogs, a single oral administration of Bravecto™, formulated as a chewable tablet, proved to be > 99% effective against fleas and ticks at each measured time-point over a period of 12 weeks following treatment [ 20 ]. The dogs in these studies were variably infested with at least four tick species, including ticks belonging to the Rhipicephalus sanguineus group, Ixodes hexagonus, Ixodes ricinus and Dermacentor reticulatus. In a simulated home environment a single oral administration of Bravecto™ formulated as chewable tablets was > 99% effective against the flea Ctenocephalides felis, at every time-point measured over a period of 12 weeks following treatment [ 21 ]. In a laboratory study designed to detect the speed of kill of Bravecto™ chewable tablets against laboratory infestations of the tick I. ricinus on dogs, acaricidal efficacy was 89.6% at 4 hours, 97.9% at 8 hours and 100% at 12 and 24 hours after treatment [ 22 ]. An even faster onset of killing activity starting at 1 hour after oral administration of Bravecto™ chewable tablets was observed in dogs experimentally infested with C. felis flea [ 23 ]. The aim of the current study was to determine a) the efficacy of fluralaner against Demodex spp. mites and b) to show efficacy duration over 12 weeks following single oral treatment with Bravecto™ chewable tablets. As positive control, a second group of dogs was treated topically three times at a 28-day interval with Advocate® (imidacloprid and moxidectin).
Study design
In the present study, Bravecto™ administered as chewable tablets on a single occasion was the test product and Advocate®, administered three times at 28-day intervals was included as a positive control. This made it possible to compare the long term efficacy of 12 weeks of a single oral treatment with Bravecto™ chewable tablets against the efficacy of Advocate® administered at a 28-day interval according to the product label.
The study was designed as a parallel group, blinded, randomized, single centre, and positive controlled efficacy study. The study was conducted in accordance with the FDA Code of Federal Regulations: Good Laboratory Practice for Nonclinical Laboratory Studies 2009 [ 24 ], and all procedures were in compliance with South African National Standard “SANS 10386:2008: The care and use of animals for scientific purposes” [ 25 ]. The protocol was submitted to the ClinVet animal ethics committee that authorized the conduct of the study.
The test system was the individual dog. Dogs with natural infestations of Demodex spp. mites and presenting clinical signs of generalized demodicosis, e.g. erythema, hair loss, comedones, follicular casts and crusts were enrolled, with consent from their owners, in the study and were returned to their owners on completion of the animal phase. Dogs included in the study were mostly mongrels and of both sexes, older than 12 months, weighed between 3.5 and 13.7 kg, and except for clinical signs of generalized demodicosis, the dogs were healthy and as far as could be determined the dogs had not been treated with a glucocorticoid or any product with a miticidal effect for at least 12 weeks prior to inclusion. Additional requirements for inclusion were that deep skin scrapings performed before treatment had to be positive for Demodex spp. mites.
Sixteen dogs (7 male and 9 female), ranked within sex in descending order of individual pre-treatment mite counts were included in the study and allocated to two equal groups. Each dog was housed individually for the duration of the study in an indoor/outdoor run, without contact between animals, and was fed once a day according to the food manufacturer’s recommendations. Potable municipal water was available ad libitum.
Each dog was acclimatized to the housing and maintenance conditions for at least 14 days before treatment. As a precautionary measure all dogs were treated subcutaneously with an antibiotic (cefovecin), appropriate for the treatment of pyoderma on Days −14, −1, 13 and 27. Additionally, on Days −14 and 27, deep skin biopsies were taken from each dog after sedation. The biopsies indicated that exudative pyoderma was present in two dogs in each group on Day −14 and that it had cleared by Day 27. Chronic dermatitis, epidermal acanthosis and hyperkeratosis was present and unchanged in all dogs on both occasions. No inflammatory cells or bacteria were observed in the Day 27 biopsies and antimicrobial therapy was discontinued. Twice during acclimatization (Day −14 and Day −1) and on Days 27/28, 56 and 84 after treatment each dog was clinically examined by a veterinarian.
The dogs were weighed on a calibrated and verified electronic scale on Days −2, 13, 27, 41, 55, 69 and 84 for dose calculation for treatment, for the use of sedatives for skin scrapings and to document the body weight during the study period. General health observations were performed daily throughout the complete study period.
On Day 0, dogs of one group were treated once orally with Bravecto™ chewable tablets (fluralaner, 13.64% w/w), based on the dog’s individual body weight, to achieve a minimum dose of 25 mg/kg body weight and an efficacy over 12 weeks following treatment. The tablet(s) was (were) administered 20 (±10) minutes after food had been offered by placement in the back of the oral cavity over the tongue to initiate swallowing. Also on Day 0, commercially available Advocate® (imidacloprid, 10%/moxidectin, 2.5% w/v) was administered topically to the other group of dogs (positive controls) according to the product label. Due to the 28 days efficacy duration of Advocate®, these dogs were re-treated on Day 28 and 56. With the dog in a standing position, the coat was parted until the skin was visible and the Advocate® was administered directly onto the skin. Both treated groups were observed prior to treatment and again hourly for 4 hours after treatment of the last animal, for possible adverse events. Personnel performing the post-treatment observations were blinded with respect to the treatment.
Mite assessments
Deep skin scrapings (
4 cm 2 ), in which the skin was squeezed and scraped until capillary oozing was seen, were made from five sites on each dog on Days −4, 28, 56 and 84. Skin scrapings of the dogs treated with Advocate® were performed on Day 28 and Day 56, before the second or third treatment was applied, respectively. The same sites and/or sites of new lesions were scraped at each subsequent examination. Each scraping was transferred to a separate labelled microscope slide containing mineral oil and was examined under a stereomicroscope for the presence of Demodex spp. mites. The numbers of mites counted in each scraping were recorded separately.
Skin and hair assessments
The clinical signs and the extent of demodectic lesions on each dog were assessed on the days when skin scrapings were made, and recorded on a standardised form. The following parameters were assessed and sketched on a silhouette (left and right hand side) for each dog: body areas exhibiting erythema; body areas covered by casts, scales and crusts; body areas with hair loss. A semi-quantitative assessment of hair re-growth was performed, comparing hair coat before, within and after the 12 weeks study duration and assessed as percentage hair re-growth (0-50%, 50-90% or > 90%) defined as estimated percentage of hair cover growth compared to baseline total hairless area as assessed prior to veterinary product administration. Colour photographs illustrating the extent of lesions and their resolution were taken of each dog on Day −4 and subsequently at approximately monthly intervals up to Day 84 after treatment.
Efficacy evaluation
The primary assessment variable in the study was the decrease in total number of mites counted in skin scrapings following treatment.
where Mpre was the mean number of pre-treatment mite counts, and Mpost the mean number of post-treatment mite counts.
Additionally, the groups were compared using an ANOVA with a treatment effect after a logarithmic transformation on the mite (count + 1) data, for each study day.
On Day 50 one of the dogs in the group treated with Advocate® developed severe oedema of the left hind leg and prepuce and the swelling did not dissipate with antibiotic, diuretic and corticosteroid treatment. The dog was removed from the study on Day 59, sedated and upon laparotomy a large nodular tumour compatible with malignant lymphoma was found attached to the ventral spine, and the dog was euthanised during surgery. The results pertaining to this dog until Day 56, before its exclusion from the study on Day 59, have been included with those of the other dogs in the group treated with Advocate®.
No adverse event considered to be related to oral treatment with Bravecto™ chewable tablets or topical treatment with Advocate® was observed in any dog.
Geometric mean reductions in Demodex spp. mite counts of dogs treated once orally with Bravecto ™ or topically on three occasions at 28-day intervals with Advocate®
Mean a mite counts (n)
Mean a mite counts (n)
Mean a mite counts (n)
Mean a mite counts (n)
a Geometric mean.
b Mite counts calculated without one dog, which was euthanized on Day 59.
c Not applicable.
Reduction in the occurrence of dermatologic changes in dogs with generalized demodicosis after treatment with either Bravecto™ or Advocate®
Bravecto ™ : occurrence of lesions on days before and after treatment (dogs were treated on Day 0: number of dogs/number of dogs per group)
Crusts, casts or scales
Advocate®; occurrence of lesions on days before and after initial treatment (dogs were treated on Days 0, 28 and 56 a : number of dogs/number of dogs per group)
Crusts, casts or scales
a Skin assessments were performed before treatment.
b On day 59 one dog had to be euthanized due to the presence of a malign tumour in the stomach.
Hair re-growth on dogs with generalized demodectic mange after treatment with Bravecto™ or Advocate®
a Percentage hair re-growth defined as estimated percentage of hair cover growth compared to baseline total hairless area as assessed prior to veterinary product administration.
b Dogs were treated once orally on Day 0.
c Dogs were treated topically on Day 0, on Day 28 and again on Day 56. Hair assessments were performed before treatment.
d On day 59 one dog had to be euthanized due to the presence of a malign tumour in the stomach.
Example of hair re-growth in a dog suffering from generalized demodicosis pre-treatment (a) and 12 weeks after initiation of treatment (b).
The body weight of every dog increased similarly in both groups during the study period.
Discussion
A single oral administration of Bravecto™ chewable tablets to dogs with naturally acquired generalized demodicosis resulted in significantly lower mean mite counts 56 and 84 days after treatment and a correspondingly greater efficacy at each time period compared to three successive treatments with Advocate® at an interval of 28 days. No mites were present in the skin scrapings of the dogs 56 or 84 days after treatment with Bravecto TM chewable tablets, while a few mites were still present in skin scrapings 56 (mite average: 18.5) and 84 (mite average: 25.6) days after the initial treatment with Advocate®.
Reduction of mite counts was consistent with reduction in the extent and severity of the skin changes. Both groups of dogs showed resolution of the associated dermatologic signs with steady improvement over the 12 week treatment period. More Bravecto™ treated dogs had resolution of crusts, casts and scales and showed hair re-growth, while none of the Advocate® treated dogs had erythema at the assessment time point Day 84.
A problem frequently encountered with the treatment of demodicosis in dogs is the inability to ensure that a dog is absolutely free from mites after completion of a specific treatment regimen and re-infestation can be detected months after a treatment that was initially considered to be successful [ 15 , 16 ]. The present results are, however, encouraging that the administration of Bravecto™ chewable tablets offers the potential to provide sustained control of demodex mite infestations in susceptible dogs for at least three months after a single treatment.
Owner compliance can be an important factor in treatment success when multiple doses of a treatment spread over a long period of time are required in order to achieve a satisfactory outcome. Bravecto™ administered once as chewable tablets is not only effective against Demodex spp. mites on dogs but remains effective for 12 weeks following treatment. Moreover, it is effective for the same period of time against ticks and fleas that may concomitantly infest these animals [ 20 , 21 ]. Therefore, the single administration may help to reduce the risk of treatment failure as a consequence of poor owner compliance with treatment recommendations.
Bravecto™ chewable tablets have proved to be safe for use in dogs at five times the recommended therapeutic dose [ 26 ]. It is also safe to use in breeding, pregnant and lactating dogs. With this in mind it could prove to be an effective prophylactic intervention against the transmission of Demodex spp. mites from a post-parturient bitch to her new-born pups aiding in the prevention and control of demodicosis in all its forms on the following generation of dogs.
Conclusions
Single oral administration of Bravecto™ chewable tablets is highly effective against generalized demodicosis, with no mites detectable at 56 and 84 days following treatment. In comparison, Advocate®, administered three times at 28-day intervals, is also highly effective against generalized demodicosis, but most dogs still harboured mites at all assessment time points. Both treatments resulted in a marked reduction of skin lesions and increase of hair re-growth 12 weeks after the initial treatment.
Declarations
Acknowledgements
The authors would like to thank all the staff at ClinVet SA for their assistance and contribution to perform the study.
Competing interests
JF and JL are employed at ClinVet and IH is employed at the Department of Veterinary Tropical Diseases, Faculty of Veterinary Science, University of Pretoria, South Africa. RF is employed at MSD Animal Health Innovation SAS, France and AH and JT are employed at MSD Animal Health Innovation GmbH, Germany.
The study was conducted as part of a research program to evaluate the efficacy of fluralaner for the treatment of generalized demodicosis in dogs compared to a positive control product.
Authors’ contributions
The study design, protocol and report of the study were prepared by RF, JF and JL, and reviewed by AH and JT. JL, JF and their team at ClinVet SA were responsible for the animal phase, data collection and statistical calculations. IH and JF were responsible for compiling the first draft of the manuscript. All authors revised and approved the final version.
Authors’ Affiliations
References
- Zumpt F. The arthropod parasites of vertebrates in Africa south of the Sahara (Ethiopian region), vol. 1. Johannesburg: Chelicerata. South African Institute for Medical Research; 1961. Google Scholar
- Desch CE, Hillier A. Demodex injai: a new species of hair follicle mite (Acari: Demodecidae) from the domestic dog (Canidae). J Med Entomol. 2003;40:146–9. View ArticlePubMedGoogle Scholar
- Tamura Y, Kawamura Y, Inoue I, Ishino S. Scanning electron microscopy description of a new species of Demodex canis spp. Vet Dermatol. 2001;12:275–8. View ArticlePubMedGoogle Scholar
- Izdebska JN, Fryderyk S. Diversity of three species of the genus Demodex (Acari, Demodecidae) parasitizing dogs in Poland. Pol J of Environ Stud. 2011;3:565–9. Google Scholar
- De Rojas M, Riazzo C, Callejón R, Guevara D, Cutillas C. Molecular study on three morphotypes of Demodex Mites (Acarina: Demodicidae) from dogs. Parasitol Res. 2012;111:2165–72. View ArticlePubMedGoogle Scholar
- Sastre N, Ravera I, Villanueva S, Altet L, Bardagit M, Sánchez A, et al. Phylogenetic relationships in three species of canine Demodex mite based on partial sequences of mitochondrial 16 s rDNA. Vet Dermatol. 2012;23:509–e101. View ArticlePubMedGoogle Scholar
- Milosevic MA, Frank LA, Brahmbhatt RA, Kania SA. PCR amplification and DNA sequencing of Demodex injai from otic secretions of a dog. Vet Dermatol. 2013;24:286–e66. View ArticlePubMedGoogle Scholar
- Paradis M. New approaches to the treatment of canine demodicosis. Vet Clin North Am Small Anim Pract. 1999;29:1425–36. View ArticlePubMedGoogle Scholar
- Scott DW, Miller WH, Griffin CE. Parasitic skin diseases. In: Scott DW, Miller WH, Griffin CE, editors. Muller and Kirk’s Small Animal Dermatology. 5th ed. Philadelphia: W B Saunders; 1995. p. 417–32. Google Scholar
- Paradis M, Pagé N. Topical (pour-on) ivermectin in the treatment of chronic generalized demodicosis in dogs. Vet Dermatol. 1998;9:55–9. View ArticleGoogle Scholar
- Shipstone M. Generalized demodicosis in dogs, clinical perspective. Aust Vet J. 2000;78:240–2. View ArticlePubMedGoogle Scholar
- Singh KS, Dimri U. The immuno-pathological conversions of canine demodicosis. Vet Parasitol. 2014;203:1–5. View ArticlePubMedGoogle Scholar
- Ordeix L, Mar Bardagí M, Scarampella F, Ferrer L, Fondati F. Demodex injai infestation and dorsal greasy skin and hair in eight wirehaired fox terrier dogs. Vet Dermatol. 2009;20:267–72. View ArticlePubMedGoogle Scholar
- Medleau L, Ristic Z. Treating chronic refractory demodicosis in dogs. Vet Med. 1994;89:775–7. Google Scholar
- Burrows AK. Generalised demodicosis in the dog: the unresponsive or recurrent case. Aust Vet J. 2000;78:244–6. View ArticlePubMedGoogle Scholar
- Mueller RS. Treatment protocols for demodicosis:an evidence-based review. Vet Dermatol. 2004;15:75–89. View ArticlePubMedGoogle Scholar
- Fourie JJ, Delport PC, Fourie LJ, Heine J, Horak IG, Krieger KJ. Comparative efficacy and safety of two treatment regimens with a topically applied combination of imidacloprid and moxidectin (Advocate®) against generalised demodicosis in dogs. Parasitol Res. 2009;105:115–24. View ArticleGoogle Scholar
- Paterson TE, Halliwell RE, Fields PJ, Louw ML, Ball G, Louw J, et al. Canine generalized demodicosis treated with varying doses of a 2.5% moxidectin + 10% imidacloprid spot-on and oral ivermectin: Parasiticidal effects and long-term treatment outcomes. Vet Parasitol. 2014;205:687–96. View ArticlePubMedGoogle Scholar
- Gassel M, Wolf C, Noack S, Williams H, Ilg T. The novel isoxazoline ectoparasiticide fluralaner: Selective inhibition of arthropod γ-aminobutyric acid- and L-glutamategated chloride channels and insecticidal/acaricidal activity. Insect Biochem Mol Biol. 2014;45:111–24. View ArticlePubMedGoogle Scholar
- Rohdich N, Roepke RKA, Zschiesche E. A randomized, blinded controlled and multi-centered field study comparing the efficacy and safety of Bravecto™ (fluralaner) against Frontline™ (fipronil) in flea- and tick-infested dogs. Parasit Vectors. 2014;7:83. View ArticlePubMed CentralPubMedGoogle Scholar
- Williams H, Young DR, Qureshi T, Zoller H, Heckeroth AR. Fluralaner, a novel isoxazoline, prevents flea (Ctenocephalides felis) reproduction in vitro and in a simulated home environment. Parasit Vectors. 2014;7:275. View ArticlePubMed CentralPubMedGoogle Scholar
- Wengenmayer C, Williams H, Zschiesche E, Moritz A, Langenstein J, Roepke RKA, et al. The speed of kill of fluralaner (Bravecto™) against Ixodes ricinus ticks on dogs. Parasit Vectors. 2014;7:525. PubMed CentralPubMedGoogle Scholar
- Taenzler J, Wengenmayer C, Williams H, Fourie J, Zschiesche E, Roepke RKA, et al. Onset of activity of fluralaner (BRAVECTO™) against Ctenocephalides felis on dogs. Parasit Vectors. 2014;7:567. PubMed CentralPubMedGoogle Scholar
- FDA US. Code of Federal Regulations Title 21, Part 58: Good Laboratory Practice For Nonclinical Laboratory Studies. US Department of Health and Human Services. MD, USA: US FDA. Center for Drug Evaluation and Research; 2009. Google Scholar
- SANS 10386: 2008. “The care and use of animals for scientific purposes” Google Scholar
- Walther FM, Allan MJ, Roepke RKA, Nuernberger MC. Safety of fluralaner chewable tablets (Bravecto™), a novel systemic antiparasitic drug, in dogs after oral administration. Parasit Vectors. 2014;7:87. View ArticlePubMed CentralPubMedGoogle Scholar
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License ( http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 ), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly credited. The Creative Commons Public Domain Dedication waiver ( http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ ) applies to the data made available in this article, unless otherwise stated.
By submitting a comment you agree to abide by our Terms and Community Guidelines. If you find something abusive or that does not comply with our terms or guidelines please flag it as inappropriate.
Papers, Zotero, Reference Manager, RefWorks (.RIS)
EndNote (.ENW)
Mendeley, JabRef (.BIB)
In these collections
Share this article
- Share on Twitter
- Share on Facebook
- Share on LinkedIn
- Share on Weibo
- Share on Google Plus
- Share on Reddit
See updates
Other Actions
Parasites & Vectors
Contact us
- Editorial email: Eric.Penea@biomedcentral.com
- Support email: info@biomedcentral.com
Follow BMC :
© 2018 BioMed Central Ltd unless otherwise stated. Part of Springer Nature.
Remedy Demodikose
Classifications
- A — HUMAN NECESSITIES
- A61 — MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61K — PREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL, OR TOILET PURPOSES
- A61K31/00 — Medicinal preparations containing organic active ingredients
- A61K31/33 — Heterocyclic compounds
- A61K31/335 — Heterocyclic compounds having oxygen as the only ring hetero atom, e.g. fungichromin
- A61K31/365 — Lactones
Description
GB 1 390 336 GB 1390336
die Reste R 1 bis R 4 die in der nachfolgenden Tabelle 1 angegebene Bedeutung haben und X für eine Einfach- oder Doppelbindung zwischen der C 22 - und C 23 -Position (-C 22 R 1 -XC 23 R 2 -) stehen kann. can, the radicals R 1 to R 4 have the meaning indicated in the following table 1 and X represents a single or double bond between the C 22 - - and C 23 position (C 22 R 23 R 1 -X 2).
sec-Bu = sekundär Butyl; sec-Bu = secondary butyl; iso-Pr = Isopropyl; iso-Pr = isopropyl; Chx = Cyclohexyl; Chx = cyclohexyl; -Me = Methyl -Me = methyl
die Reste R 1 bis R 5 die in der nachfolgenden Tabelle 2 angegebene Bedeutung haben: Tabelle 2 the radicals R 1 to R 5 have the meaning indicated in the following Table 2: Table 2 iso-Pr = Isopropyl iso-Pr = isopropyl
Avermectin B 1a /B 1b (bzw. Abamectin) Avermectin B 1a / B 1b (or abamectin)
22,23-Dihydroavermectin B 1a /B 1b (bzw. Ivermectin B 1a /B 1b ) 22,23-dihydroavermectin B 1a / B 1b (or Ivermectin B 1a / B 1b)
Lösungen, beispielsweise Lösungen zum Gebrauch auf der Haut oder in Körperhöhlen, Aufgußformulierungen, Gele; Solutions such as solutions for use on the skin or in body cavities, pour-on formulations, gels;
Emulsionen und Suspensionen, halbfeste Zubereitungen. Emulsions and suspensions, semisolid preparations.
Wasser, Alkohole wie zB Ethanol, Isopropanol, Propylenglykol, Glycerol, Sorbitol und ihre Gemische. Water, alcohols such as ethanol, isopropanol, propylene glycol, glycerol, sorbitol and their mixtures.
ampholytische Tenside wie Di-Na-N-lauryl-β-iminodipropionat oder Lecithin; ampholytic surfactants such as di-Na-N-lauryl-β-iminodipropionate or lecithin;
anionaktive Tenside, wie Na-Laurylsulfat, Fettalkoholethersulfate, Mono/Dialkylpolyglykoletherorthophosphorsäureester-monoethanolaminsalz; anionic surfactants such as Na lauryl sulphate, fatty alcohol ether sulfates, mono / Dialkylpolyglykoletherorthophosphorsäureester-monoethanolamine salt;
kationaktive Tenside wie Cetyltrimethylammoniumchlorid. cationic surfactants such as cetyltrimethylammonium chloride.
R für Wasserstoff, gegebenenfalls substituierte Reste der Gruppe Acyl, Alkyl, Aryl, Aralkyl, Heteroaryl, Heteroarylalkyl oder Heterocyclylalkyl steht; R is hydrogen, optionally substituted radicals of the group acyl, alkyl, aryl, aralkyl, heteroaryl, heteroarylalkyl or heterocyclylalkyl;
A für eine monofunktionelle Gruppe aus der Reihe Wasserstoff, Acyl, Alkyl, Aryl steht oder für eine bifunktionelle Gruppe steht, die mit dem Rest Z verknüpft ist; A represents a monofunctional group from the series hydrogen, acyl, alkyl, aryl or represents a bifunctional group which is linked to the radical Z;
E für einen elektronenziehenden Rest steht; E represents an electron-withdrawing radical;
X für die Reste -CH= oder =N- steht, wobei der Rest -CH= anstelle eines H-Atoms mit dem Rest Z verknüpft sein kann; X represents the radicals -CH = or = N-, wherein the radical -CH = can be linked instead of an H atom to the radical Z;
Z für eine monofunktionelle Gruppe aus der Reihe Alkyl, -OR, -SR, Z represents a monofunctional group from the series alkyl, -OR, -SR, wobei in which
R für gleiche oder verschiedene Reste steht und die oben angegebene Bedeutung hat, R represents identical or different radicals and has the abovementioned meaning,
oder Z für eine bifunktionelle Gruppe steht, die mit dem Rest A oder dem Rest X verknüpft ist. or Z represents a bifunctional group which is linked to the radical A or the radical X.
R steht für Wasserstoff sowie für gegebenenfalls substituierte Reste aus der Reihe Acyl, Alkyl, Aryl, Aralkyl, Heteroaryl, Heteroarylalkyl, Heterocyclylalkyl. R represents hydrogen and represents optionally substituted radicals from the series acyl, alkyl, aryl, aralkyl, heteroaryl, heteroarylalkyl, heterocyclylalkyl.
Als Acylreste seien genannt Formyl, (C 1-8 -Alkyl)-carbonyl, (C 6-10 -Aryl)-carbonyl, (C 1-8 -Alkyl)-sulfonyl, (C 6-10 -Aryl)-sulfonyl, (C 1-8 -Alkyl)-(C 6-10 -Aryl)-phosphoryl, die ihrerseits substituiert sein können. Acyl radicals which may be mentioned formyl, (C 1-8 alkyl) carbonyl, (C 6-10 aryl) carbonyl, (C 1-8 alkyl) sulfonyl, (C 6-10 aryl) sulfonyl, (C 1-8 alkyl) - (C 6-10 aryl) -phosphoryl, which may in turn be substituted.
Als Alkyl seien genannt C 1-10 -Alkyl, insbesondere C 1-4 -Alkyl, im einzelnen Methyl, Ethyl, i-Propyl, sec.- oder t.-Butyl, die ihrerseits substituiert sein können. As alkyl there may be mentioned C 1-10 -alkyl, especially C 1-4 alkyl, ethyl, i-propyl, sec- specifically methyl, or t-butyl, which may in turn be substituted.
Aryl ist insbesondere C 6-10 -Aryl, als Beispiele seien genannt Phenyl, Naphthyl, insbesondere Phenyl. Aryl is preferably C 6-10 aryl, examples which may be mentioned are phenyl, naphthyl, especially phenyl.
Aralkyl ist insbesondere (C 6-10 -Aryl)-(C 1-4 -Alkyl), als Beispiele seien genannt Phenylmethyl, Phenethyl. Aralkyl, in particular (C 6-10 aryl) - (C 1-4 alkyl), examples which may be mentioned phenylmethyl, phenethyl.
Als Heteroaryl seien genannt Heteroaryl mit bis zu 10 Ringatomen und N, O, S insbesondere N als Heteroatomen. As a heteroaryl may be mentioned heteroaryl having up to 10 ring atoms and N, O, S especially N as heteroatoms. Im einzelnen seien genannt Thienyl, Furyl, Thiazolyl, Imidazolyl, Pyridyl, Benzthiazolyl. The following may be mentioned thienyl, furyl, thiazolyl, imidazolyl, pyridyl, benzothiazolyl.
Heteroarylalkyl ist insbesondere Heteroaryl-(C 1-4 -Alkyl), wobei Heteroaryl wie vorstehend definiert ist. Heteroarylalkyl is, in particular heteroaryl (C 1-4 alkyl), where heteroaryl is as defined above. Als Beispiele seien genannt Heteroarylmethyl, Heteroarylethyl mit bis zu 6 Ringatomen und N, O, S, insbesondere N als Heteroatomen. As examples may be mentioned heteroarylmethyl, heteroarylethyl having up to 6 ring atoms and N, O, S, especially N as heteroatoms.
Heterocyclyl ist insbesondere ein ungesättiger aber nicht aromatischer oder gesättigter Heterocyclus mit bis zu 6 Ringatomen, enthaltend bis zu 3 Heteroatome ausgewählt aus N, O, S, zum Beispiel Tetrahydrofuryl. Heterocyclyl is in particular an unsaturated but not aromatic or saturated heterocycle having up to 6 ring atoms containing up to 3 heteroatoms selected from N, O, S, for example tetrahydrofuryl.
Heterocyclylalkyl ist insbesondere Heterocyclyl-C 1-2 -Alkyl, zB: Tetrahydrofuranylmethyl und Tetrahydrofuranylethyl. Heterocyclylalkyl is, in particular heterocyclyl-C 1-2 alkyl, for example: tetrahydrofuranylmethyl and Tetrahydrofuranylethyl.
Als Substituenten seien beispielhaft und vorzugsweise aufgeführt: Substituents may be mentioned by way of example and preferably:
Alkyl mit vorzugsweise 1 bis 4, insbesondere 1 oder 2 Kohlenstoffatomen, wie Methyl, Ethyl, n- und i-Propyl und n-, i- und t-Butyl; Alkyl having preferably 1 to 4, in particular 1 or 2 carbon atoms such as methyl, ethyl, n- and i-propyl and n-, i- and t-butyl; Alkoxy mit vorzugsweise 1 bis 4, insbesondere 1 oder 2 Kohlenstoffatomen, wie Methoxy, Ethoxy, n- und i-Propyloxy und n-, i- und t-Butyloxy; Alkoxy having preferably 1 to 4, in particular 1 or 2 carbon atoms, such as methoxy, ethoxy, n- and i-propyloxy and n-, i- and t-butyloxy; Alkylthio mit vorzugsweise 1 bis 4, insbesondere 1 oder 2 Kohlenstoffatomen, wie Methylthio, Ethylthio, n- und i-Propylthio und n-, i- und t-Butylthio; Alkylthio having preferably 1 to 4, in particular 1 or 2 carbon atoms, such as methylthio, ethylthio, n- and i-propylthio and n-, i- and t-butylthio; Halogenalkyl mit vorzugsweise 1 bis 4, insbesondere 1 oder 2 Kohlenstoffatomen und vorzugsweise 1 bis 5, insbesondere 1 bis 3 Halogenatomen, wobei die Halogenatome gleich oder verschieden sind und als Halogenatome, vorzugsweise Fluor, Chlor oder Brom, insbesondere Fluor stehen, wie Trifluormethyl; Halogenoalkyl having preferably 1 to 4, in particular 1 or 2 carbon atoms and preferably 1 to 5, in particular 1 to 3 halogen atoms, the halogen atoms being identical or different and the halogen atoms, fluorine, chlorine or bromine, in particular preferably fluorine, such as trifluoromethyl; Hydroxy; hydroxy; Halogen, vorzugsweise Fluor, Chlor, Brom und Jod, insbesondere Fluor, Chlor und Brom; Halogen, preferably fluorine, chlorine, bromine and iodine, especially fluorine, chlorine and bromine; Cyano; cyano; Nitro; nitro; Amino; amino; Monoalkyl- und Dialkylamino mit vorzugsweise 1 bis 4, insbesondere 1 oder 2 Kohlenstoffatomen je Alkylgruppe, wie Methylamino, Methyl-ethyl-amino, n- und i-Propylamino und Methyl-n-butylamino; Monoalkyl and dialkylamino having preferably 1 to 4, in particular 1 or 2 carbon atoms per alkyl group, such as methylamino, methyl-ethyl-amino, n- and i-propylamino and methyl-n-butylamino; Carboxyl; carboxyl; Carbalkoxy mit vorzugsweise 2 bis 4, insbesondere 2 oder 3 Kohlenstoffatomen, wie Carbomethoxy und Carboethoxy; Carbalkoxy having preferably 2 to 4, especially 2 or 3 carbon atoms, such as carbomethoxy and carboethoxy; Sulfo (SO 3 H), Alkylsulfonyl mit vorzugsweise 1 bis 4, insbesondere 1 oder 2 Kohlenstoffatomen, wie Methylsulfonyl und Ethylsulfonyl; Sulfo (SO 3 H), alkylsulphonyl having preferably 1 to 4, in particular 1 or 2 carbon atoms, such as methylsulfonyl and ethylsulfonyl; Arylsulfonyl mit vorzugsweise 6 oder 10 Arylkohlenstoffatomen, wie Phenylsulfonyl sowie Heteroarylamino und Heteroarylalkylamino wie Chlorpyridylamino und Chlorpyridylmethylamino. Arylsulfonyl having preferably 6 or 10 aryl carbon atoms, such as phenylsulphonyl, and heteroarylamino and heteroarylalkylamino such as chloropyridylamino and chloropyridylmethylamino.
A steht besonders bevorzugt für Wasserstoff sowie für gegebenenfalls substituierte Reste aus der Reihe Acyl, Alkyl, Aryl, die bevorzugt die bei R angegebenen Bedeutungen haben. A particularly preferably represents hydrogen and represents optionally substituted radicals from the series acyl, alkyl, aryl, which preferably have the meanings indicated for R. A steht ferner für eine bifunktionelle Gruppe. A furthermore represents a bifunctional group. Genannt sei gegebenenfalls substituiertes Alkylen mit 1-4, insbesondere 1-2 C-Atomen, wobei als Substituenten die weiter oben aufgezählten Substituenten genannt seien und wobei die Alkylengruppen durch Heteroatome aus der Reihe N, O, S unterbrochen sein können. There may be mentioned optionally substituted alkylene having 1-4, in particular 1-2 C-atoms, wherein the substituents listed further above may be mentioned as substituents, and wherein the alkylene groups may be interrupted by heteroatoms from the series N, O, S.
A und Z können gemeinsam mit den Atomen, an welche sie gebunden sind, einen gesättigten oder ungesättigten heterocyclischen Ring bilden. A and Z together with the atoms to which they are attached form a saturated or unsaturated heterocyclic ring. Der heterocyclische Ring kann weitere 1 oder 2 gleiche oder verschiedene Heteroatome und/oder Heterogruppen enthalten. The heterocyclic ring can contain a further 1 or 2 identical or different heteroatoms and / or hetero groups. Als Heteroatome stehen vorzugsweise Sauerstoff, Schwefel oder Stickstoff und als Heterogruppen N-Alkyl, wobei Alkyl der N-Alkyl-Gruppe vorzugsweise 1 bis 4, insbesondere 1 oder 2 Kohlenstoffatome enthält. Hetero atoms are preferably oxygen, sulfur or nitrogen and hetero groups are N-alkyl, where alkyl of the N-alkyl group contains preferably 1 to 4, in particular 1 or 2 carbon atoms. Als Alkyl seien Methyl, Ethyl, n- und i-Propyl und n-, i- und t-Butyl genannt. As alkyl are methyl, ethyl, n- and i-propyl and n-, i- and t-butyl. Der heterocyclische Ring enthält 5 bis 7, vorzugsweise 5 oder 6 Ringglieder. The heterocyclic ring contains 5 to 7, preferably 5 or 6 ring members.
Als Beispiele für den heterocyclischen Ring seien Pyrrolidin, Piperidin, Piperazin, Hexamethylenimin, Hexahydro-1,3,5-triazin, Morpholin und Oxadiazin genannt, die gegebenenfalls bevorzugt durch Methyl substituiert sein können. As examples of the heterocyclic ring are pyrrolidine, piperidine, piperazine, hexamethyleneimine, hexahydro-1,3,5-triazine, morpholine and oxadiazine be mentioned, which may be substituted by methyl, may be preferred.
E steht für einen elektronentziehenden Rest, wobei insbesondere NO 2 , CN, Halogenalkylcarbonyl wie Halogen-C 1-4 -alkylcarbonyl mit 1 bis 9 Halogenatomen, insbesondere COCF 3 , sowie C 1-4 -Alkylsulfonyl und Halogen-C 1-4 -alkylsulfonyl mit 1 bis 9 Halogenatomen, insbesondere SO 2 CF 3 , genannt seien. E represents an electron-withdrawing radical, in particular NO 2, CN, halogenoalkylcarbonyl such as halogeno-C 1-4 alkylcarbonyl having 1 to 9 halogen atoms, in particular COCF 3, and C 1-4 -alkylsulfonyl and halo-C 1-4 -alkylsulfonyl having 1 to 9 halogen atoms, in particular SO 2 CF 3 may be mentioned.
X steht für -CH= oder -N= X stands for -CH = or -N =
Z steht für gegebenenfalls substituierte Reste Alkyl, -OR, -SR, -NRR, wobei R und die Substituenten bevorzugt die oben angegebene Bedeutung haben. Z represents optionally substituted radicals alkyl, -OR, -SR, -NRR, where R and the substituents preferably have the meaning given above.
Z kann außer dem obengenannten Ring gemeinsam mit dem Atom, an welches es gebunden ist und dem Rest Z may in addition to the abovementioned ring, together with the atom to which it is attached and the radical an der Stelle von X einen gesättigten oder ungesättigten heterocyclischen Ring bilden. in the place of X, a saturated or unsaturated heterocyclic ring. Der heterocyclische Ring kann weitere 1 oder 2 gleiche oder verschiedene Heteroatome und/oder Heterogruppen enthalten. The heterocyclic ring can contain a further 1 or 2 identical or different heteroatoms and / or hetero groups. Als Heteroatome stehen vorzugsweise Sauerstoff, Schwefel oder Stickstoff und als Heterogruppen N-Alkyl, wobei die Alkyl oder N-Alkyl-Gruppe vorzugsweise l bis 4, insbesondere 1 oder 2 Kohlenstoffatome enthält. Hetero atoms are preferably oxygen, sulfur or nitrogen and hetero groups are N-alkyl, where the alkyl or N-alkyl group preferably contains from l to 4, in particular 1 or 2 carbon atoms. Als Alkyl seien Methyl, Ethyl, n- und i-Propyl und n-, i- und t-Butyl genannt. As alkyl are methyl, ethyl, n- and i-propyl and n-, i- and t-butyl. Der heterocyclische Ring enthält 5 bis 7, vorzugsweise 5 oder 6 Ringglieder. The heterocyclic ring contains 5 to 7, preferably 5 or 6 ring members.
Als Beispiele für den heterocyclischen Ring seien Pyrrolidin, Piperidin, Piperazin, Hexamethylenimin, Morpholin und N-Methylpiperazin genannt. As examples of the heterocyclic ring are pyrrolidine, piperidine, piperazine, hexamethyleneimine, morpholine and N-methylpiperazine may be mentioned.
n für 1 oder 2 steht, n is 1 or 2;
m für 0, 1 oder 2 steht, m is 0, 1 or 2;
Subst. für einen der oben aufgeführten Substituenten, insbesonders für Halogen, ganz besonders für Chlor, steht, Subst. For one of the abovementioned substituents, in particular halogen, especially for chlorine,
A, Z, X und E die oben angegebenen Bedeutungen haben. A, Z, X and E have the meanings given above.
Als Lösungsmittel A wird Benzylalkohol oder ein gegebenenfalls substituiertes Pyrrolidon, eingesetzt. As the solvent A is benzyl alcohol or optionally substituted pyrrolidone, are used. Gegebenenfalls substituierte Pyrrolidone sind z. Optionally substituted pyrrolidones are, for. B. 2-Pyrrolidon; B. 2-pyrrolidone; 1-(C 1 -C 10 )-Pyrrolidon-2 wie 1-Methylpyrrolidon, 1-Ethylpyrrolidon, 1-Octylpyrrolidon, 1-Dodecylpyrrolidon, 1-Isopropylpyrrolidon, 1-(n-, sek.- oder tert.-Butyl)-Pyrrolidon, 1-Hexylpyrrolidon; 1- (C 1 -C 10) -pyrrolidone-2 such as 1-methylpyrrolidone, 1-ethylpyrrolidone, 1-octylpyrrolidone, 1-dodecylpyrrolidone, 1-Isopropylpyrrolidon, 1- (n-, sec- or tert-butyl) - pyrrolidone, 1-hexylpyrrolidone; 1(C 2 -C 10 -Alkenyl)-pyrrolidon-2 wie 1-Vinylpyrrolidon-2; 1 (C 2 -C 10 alkenyl) pyrrolidone-2, such as 1-vinyl pyrrolidone-2; 1-(C 3 -C 8 -Cycloalkyl)-pyrrolidon-2 wie 1-Cyclohexylpyrrolidon; 1- (C 3 -C 8 cycloalkyl) -pyrrolidone-2 such as 1-cyclohexylpyrrolidone; 1-(3-Hydroxypropyl)-pyrrolidon, l-(2-Methoxyethyl)-pyrrolidon, 1-(3-Methoxyproypl)-pyrrolidon, 1-Benzylpyrrolidon. 1- (3-hydroxypropyl) -pyrrolidone, l- (2-methoxyethyl) -pyrrolidone, 1- (3-Methoxyproypl) pyrrolidone, 1-Benzylpyrrolidon. Von diesen besonders bevorzugt ist Benzylalkohol. Of these, particularly preferred is benzyl alcohol.
Priority Applications (1)
Applications Claiming Priority (4)
Publications (1)
ID=35614662
Family Applications (1)
Country Status (4)
Cited By (1)
Families Citing this family (3)
Family Cites Families (16)
Cited By (1)
Also Published As
Similar Documents
Legal Events
Owner name: BAYER ANIMAL HEALTH GMBH, 51373 LEVERKUSEN, DE
Treatment of demodicosis in dogs: 2011 clinical practice guidelines
Ralf S. Mueller,
- Centre for Clinical Veterinary Medicine, Ludwig Maximilian University Munich, Veterinaerstraße 13, 80539 Munich, Germany
Emmanuel Bensignor,
- Dermatology Referral Service, 75003 Paris, 35510 Rennes-Cesson and 44000 Nantes, France
Lluís Ferrer,
- Department of Animal Medicine and Surgery, Universitat Autonome de Barcelona, 08193 Bellaterra, Spain
Birgit Holm,
- The Blue Star Small Animal Hospital, Gjutjärnsgatan 4, SE-417 07 Gothenburg, Sweden
Stephen Lemarie,
- Southeast Veterinary Specialists, 3409 Division Street, Metairie, LA 70002, USA
Manon Paradis,
- Department of Clinical Sciences, Faculté de Médecine Vétérinaire, University of Montreal, CP 5000, St-Hyacinthe, Québec, Canada J2S 7C6
Michael A. Shipstone
- Dermatology for Animals, 263 Appleby Road, Stafford Heights, QLD 4053, Australia
- First published: 13 February 2012 Full publication history
- DOI: 10.1111/j.1365-3164.2011.01026.x View/save citation
- Cited by (CrossRef): 19 articles Check for updates
Sources of Funding: This study is self-funded.
Conflict of Interest: In the last 5 years, Ralf Mueller has obtained funding, lectured or consulted for Bayer Animal Health, Boehringer Ingelheim, Dechra Veterinary Products, Intervet, Merial, Novartis Animal Health, Pfizer Animal Health, Procter & Gamble, Royal Canin, Selectavet and Virbac. Emmanuel Bensignor has obtained funding for studies, lectured or consulted for the following companies selling products for demodicosis: Bayer Animal Health, Novartis Animal Health and Pfizer Animal Health. Lluís Ferrer has obtained funding, lectured or consulted for Novartis, Bayer Animal Health, Virbac, Merial, Intervet, Esteve Veterinaria and Elanco. Birgit Holm has obtained funding for studies, lectured or consulted for Bayer Animal Health and Novartis Animal Health. Manon Paradis has participated in a study funded by Bayer Animal Health. Michael Shipstone has received funding for studies and lectures from Pfizer Animal Health, Schering Plough and Virbac Australia.
Ralf S. Mueller, Centre for Clinical Veterinary Medicine, Ludwig Maximilian University Munich, Veterinaerstraße 13, 80539 Munich, Germany. E-mail: ralf.mueller@med.vetmed.uni-muenchen.de
Background and Objectives – These guidelines were written by an international group of specialists with the aim to provide veterinarians with current recommendations for the diagnosis and treatment of canine demodicosis.
Methods – Published studies of the various treatment options were reviewed and summarized. Where evidence in form of published studies was not available, expert consensus formed the base of the recommendations.
Results – Demodicosis can usually be diagnosed by deep skin scrapings or trichograms; in rare cases a skin biopsy may be needed for diagnosis.
Immune suppression due to endoparasitism or malnutrition in young dogs and endocrine diseases, neoplasia and chemotherapy in older dogs are considered predisposing factors and should be diagnosed and treated to optimize the therapeutic outcome. Dogs with disease severity requiring parasiticidal therapy should not be bred.
Secondary bacterial skin infections frequently complicate the disease and require topical and/or systemic antimicrobial therapy.
There is good evidence for the efficacy of weekly amitraz rinses and daily oral macrocyclic lactones such as milbemycin oxime, ivermectin and moxidectin for the treatment of canine demodicosis. Weekly application of topical moxidectin can be useful in dogs with milder forms of the disease. There is some evidence for the efficacy of weekly or twice weekly subcutaneous or oral doramectin. Systemic macrocyclic lactones may cause neurological adverse effects in sensitive dogs, thus a gradual increase to the final therapeutic dose may be prudent (particularly in herding breeds).
Treatment should be monitored with monthly skin scrapings and extended beyond clinical and microscopic cure to minimize recurrences.
Editor’s Note – A brief review article by R. Mueller has been published: Evidence-based treatment of canine demodicosis, Tierarztl Prax Ausg K Kleintiere Heimtiere 2011; 39: 419–24. This is not considered to constitute duplication of the article published here in Veterinary Dermatology.
La démodécie canine est fréquente en pratique des petits animaux et il existe un certain nombre de traitements possible. Ces recommandations ont étéécrites par un groupe international de spécialistes avec l’objectif de les fournir aux vétérinaires pour le diagnostic et le traitement de cette maladie. Les études publiées sur les différentes options de traitement ont été examinées et résumées. Lorsque les preuves n’étaient pas disponibles pour certaines publications, un consensus d’experts formait la base des recommandations. La démodécie est généralement diagnostiquée par raclages cutanés profonds ou par trichogrammes ; dans de rares cas une biopsie cutanée peut être requise. Les facteurs compromettants le système immunitaire, tels que l’endoparasitisme ou la malnutrition chez les jeunes chiens, les dysendocrinies, les tumeurs et la chimiothérapie chez les vieux chiens, sont considérés comme des facteurs prédisposants et devraient être diagnostiqués et traités afin d’optimiser les résultats thérapeutiques. Les chiens dont la sévérité de la maladie nécessite un traitement antiparasitaire ne devraient pas être reproduits. Les infections bactériennes cutanées secondaires compliquent fréquemment la maladie et nécessitent un traitement antimicrobien topique et/ou systémique. Dans le traitement de la démodécie canine, le niveau de preuve est bon concernant l’efficacité de bains hebdomadaires d’amitraz à 250–500 p.p.m. et l’administration orale quotidienne de lactones macrocycliques telles que la milbémycine oxime à 1–2 mg/kg, l’ivermectine à 0.3–0.6 mg/kg et la moxidectine à 0.2–0.4 mg/kg. L’application hebdomadaire de moxidectine topique peut être utile chez les chiens présentant une forme modérée de la maladie. Il existe certaines preuves de l’efficacité de la doramectine sous-cutanée ou orale, hebdomadaire ou bihebdomadaire à 0.6 mg/kg. Les lactones macrocycliques systémiques peuvent engendrer des effets secondaires neurologiques chez les chiens sensibles ; il serait prudent d’augmenter la dose progressivement jusqu’à la dose finale thérapeutique (en particulier chez les bergers) afin de mettre en évidence les chiens ne tolérant pas ces molécules. Le traitement doit être contrôlé par des raclages cutanés mensuels et doit être prolongé au delà de la guérison clinique et microscopique afin de minimiser les récidives.
La demodicosis canina es frecuente en las consultas de pequeños animales y existen varias terapias posibles. Estas directrices han sido escritas por un grupo internacional de especialistas con el propósito de proporcionar a los veterinarios las recomendaciones mas actuales para el diagnostico y el tratamiento de esta enfermedad. Se revisaron y resumieron los estudios publicados donde se exponían diversas opciones de tratamiento. En los casos en que no había clara evidencia del tratamiento en forma de estudios publicados, la base de las recomendaciones fue el consenso de los expertos. La demodicosis puede ser generalmente diagnosticada mediante raspados profundos de la piel o en tricogramas; y en casos raros una biopsia de la piel podría ser necesaria para el diagnostico. Factores que comprometen el sistema inmune, tal como el endoparasitismo o la malnutrición en perros jóvenes y enfermedades endocrinas, neoplasia y quimioterapia en perros más viejos, se consideran elementos que favorecen la infección y se deben diagnosticar y tratar para optimizar el resultado terapéutico. Los perros con enfermedad severa que requiere terapia parasiticida no deben ser utilizados con propósito de cría. Las infecciones bacterianas secundarias en la piel complican la enfermedad y requieren con frecuencia terapia antimicrobiana tópica y/o sistémica. Hay clara evidencia al respecto de la eficacia de los lavados semanales con amitraz a 250–500 p.p.m. y del tratamiento diario con lactonas macrocíclicas orales tales como la oxima de milbemicina a 1–2 mg/kg, la ivermectina a 0.3–0.6 mg/kg y la moxidectina a 0.2–0.4 mg/kg para el tratamiento de la demodicosis canina. El uso semanal de moxidectin por vía tópica puede ser útil en perros con formas más leves de la enfermedad. Hay cierta evidencia relativa a la eficacia del semanal o dos veces en semana de doramectina subcutánea u oral a dosis de 0.6 mg/kg. Las lactonas macrocíclicas por vía sistémica pueden causar efectos nocivos neurológicos en perros sensibles, por lo que un aumento gradual hasta la dosis terapéutica final podría ser prudente (particularmente en razas de perros pastores) para identificar con prontitud los perros que no toleran esos fármacos. El tratamiento se debe supervisar con raspados mensuales de la piel y debe extenderse pasada la curación clínica y microscópica para reducir al mínimo las recidivas.
Zusammenfassung
Die canine Demodikose ist eine häufige Erkrankung in der Kleintierpraxis mit mehreren Therapiemöglichkeiten. Diese Richtlinien wurden von einer internationalen Gruppe von Spezialisten mit dem Ziel, TierärztInnen die momentanen Empfehlungen zur Diagnose und zur Therapie der Erkrankung zur Verfügung zu stellen, geschrieben. Die publizierten Studien der unterschiedlichen Behandlungsmethoden wurden ‘reviewed’ und zusammengefasst. Wo keine Evidenz in Form von publizierten Studien bestand, wurde der Consensus der ExpertInnen als Basis für die Empfehlungen herangezogen. Die canine Demodikose kann normalerweise mittels tiefer Hautgeschabsel oder Trichgramm diagnostiziert werden; in seltenen Fällen ist für die Diagnose eine Hautbiopsie nötig. Faktoren, die das Immunsystem beeinträchtigen, wie Endoparasiten oder schlechte Ernährung bei Junghunden, sowie endokrine Erkrankungen, Neoplasien und Chemotherapie bei älteren Hunden werden als prädisponierende Faktoren angesehen und sollten diagnostiziert und behandelt werden, um den Therapieerfolg zu optimieren. Mit Hunden, die die Erkrankung in einem Schweregrad aufweisen, die eine Therapie mit Antiparasitika notwendig macht, sollte nicht gezüchtet werden. Sekundäre bakterielle Infektionen verkomplizieren häufig die Erkrankung und erfordern eine topische und/oder systemische antimikrobielle Behandlung. Es besteht eine gute Evidenz für die Wirksamkeit von wöchentlichen Amitraz Bädern in einer Dosierung von 250–500 p.p.m. und tägliche orale Verabreichung von makrozyklischen Laktonen, wie Milbemycinoxim in einer Dosierung von 1–2 mg/kg, Ivermectin in einer Dosierung von 0.3–0.6 mg/kg und Moxidectin in einer Dosierung von 0.2–0.4 mg/kg zur Behandlung der caninen Demosikose. Eine wöchentliche topische Verabreichung von Moxidectin kann bei Hunden mit einer weniger stark ausgeprägten Erkrankung hilfreich sein. Teilweise besteht Evidenz für die Wirksamkeit wöchentlicher oder zweimal wöchentlicher subkutaner oder oraler Verabreichung von Doramectin in einer Dosierung von 0.6 mg/kg. Systemisch verabreichte makrozyklische Laktone können bei empfänglichen Hunden neurologische Nebenwirkungen verursachen, daher ist als Vorsichtsmaßnahme ein gradueller Anstieg der Dosierung bis zur letztendlich verabreichten Dosis (vor allem bei Herdenhunden) sinnvoll, um jene Hunde zu identifizieren, die diese Wirkstoffe eventuell nicht tolerieren können. Die Behandlung sollte monatlich durch Hautgeschabsel kontrolliert werden und um Rückfälle zu vermeiden, über eine klinische sowie eine mikroskopische Heilung hinaus gegeben werden.
Introduction
Objectives and explanation of this document
In humans, evidence-based medicine is not only an academic buzz word but has reached general practice. The Cochrane Collaboration (http://www.cochrane.org/) provides reviews and treatment guidelines for many common diseases and is available at no cost worldwide to anyone with Internet access. In veterinary dermatology, the first evidence-based medicine review was published in 2003 about treatments for canine atopic dermatitis. 1 This was followed with a Cochrane-type review 2 and practice guidelines publication for treatment of canine atopic dermatitis in 2010. 3 These guidelines are available in a number of different languages as open access. Other topics in veterinary dermatology, such as fungal infections, leishmaniosis or otitis caused by Pseudomonas, have also been the subject of published evidence-based reviews. 4–6
Demodicosis is a common skin disease of the dog. Despite a number of studies evaluating pathogenesis and therapeutic options, treatment of canine demodicosis is still a matter of discussion in many conferences and continuing education courses. In October 2010, an international committee was founded to establish current evidence-based guidelines for treating canine demodicosis in practice. The committee consisted of members with long-standing interest in canine demodicosis as documented by several publications in the field, namely (in alphabetical order) Emmanuel Bensignor (France), Lluís Ferrer (Spain), Birgit Holm (Sweden), Stephen Lemarie (USA), Ralf S. Mueller (Germany), Manon Paradis (Canada) and Michael Shipstone (Australia). The aim of this committee was to develop best-practice guidelines for the treatment of canine demodicosis based on published evidence of efficacy. These guidelines are supported by the American College of Veterinary Dermatology, the Asian College of Veterinary Dermatology, the Asian Society of Veterinary Dermatology, the Canadian Society of Veterinary Dermatology, the Dermatology Chapter of the Australian College of Veterinary Scientists and the European Society of Veterinary Dermatology.
General comments
Throughout this article, recommendations for specific interventions were made based on the category of evidence (COE) described in Table 1 and on the highest evidence available at the time of writing. The categories have been modified from the human literature 7 and a recent evidence review of treatment options for canine atopic dermatitis. 2 In general, recommendations of lower roman numeral numbers should be considered of greater value than those with higher grades.
For most of the recommendations in this article, the evidence was derived from results of a recent systematic review 8 (COE I) or clinical trials (COE II). There are few randomized controlled studies published evaluating therapeutic options for canine demodicosis. 9,10 To the authors’ knowledge, there is not a single placebo-controlled clinical trial, and the rate of spontaneous remission of dogs with generalized demodicosis is not known. The use of recommended treatments will not always result in complete clinical and microscopic remission or even in a response acceptable to the owner. Likewise, insufficient evidence does not imply that a specific drug is not effective but rather that there are no published studies documenting efficacy or lack thereof.
Recommendations for a specific intervention did not take into consideration whether a product was available in a specific country and whether it was licensed for use in dogs and, specifically, to treat canine demodicosis. Before implementing these guidelines into practice, veterinarians need to verify the legality of using the various veterinary pharmaceutical products and treatment protocols in their respective countries. Finally, a one-page summary is provided at the end of this article.
Pathogenesis of the disease
Demodex mites are considered to be a normal part of the cutaneous microfauna in the dog 11 and are transmitted from the bitch to the pups during the first days of life. 12 Puppies raised in isolation after caesarean section do not have any Demodex mites. It is assumed that immunosuppression or a defect in the skin immune system allows for mites to proliferate in hair follicles, resulting in clinical signs. 12 In addition to the most commonly encountered Demodex mite (D. canis), two other morphologically different types have been reported. 13,14 One is the long-bodied D. injai, a mite commonly associated with greasy/oily skin and coat. 15–18 The other is a short–bodied mite 13 that has been reported in association with D. canis. 19,20 However, more recent evidence has been presented that these different forms are all D. canis. 21 Final determination will require genetic/molecular testing. Published data indicate similar efficacy of reported treatments regardless of the Demodex type (COE I).
In young animals, endoparasiticism, 22 malnutrition and debilitation may lead to an immunocompromized state that favours mite proliferation and development of skin disease. In adult animals, chemotherapy, neoplasms, hypothyroidism or hyperadrenocorticism, for example, may suppress the immune system sufficiently to trigger proliferation of the mites. 23–25 However, studies proving a cause–effect relationship between these factors and demodicosis are lacking. Many immunosuppressed dogs never develop demodicosis, and in many cases an underlying cause may not be found. In many publications, a juvenile-onset and an adult-onset form of the disease are differentiated. 23–26 However, this differentiation may be difficult in individual cases. It is more important to identify and correct predisposing factors (such as endoparasitism or underlying diseases) independent of age to achieve the best possible outcome (COE IV).
Demodicosis in the dog is differentiated in a localized versus a generalized form. Localized demodicosis has a good prognosis, with the overwhelming majority of cases spontaneously resolving without miticidal treatment (COE V). 27 Topical antiseptic therapy may be recommended to prevent or treat a secondary bacterial skin infection (COE V). 27 Generalized demodicosis may be a severe and potentially life-threatening disease. The number of dogs with generalized demodicosis showing spontaneous cure is unknown at this time, although evidence for spontaneous remission in a subset of cases was recently presented. 28 The definition of localized versus generalized demodicosis has been a matter of debate. The reported lesion extent consistent with localized disease ranges from four lesions to 50% of the body surface. 29,30 This committee considers demodicosis localized if there are no more than four lesions with a diameter of up to 2.5 cm (COE V).
Clinical signs
Mild erythema, comedones and scaling may be the only lesions in mildly affected dogs. Partial or complete alopecia may develop. Multiple coalescing foci of alopecia and follicular papules characterize demodicosis of moderate severity. Follicular casts (scales adhering to the hair shafts) may be present. Follicular pustules and, in severe cases, furunculosis with scales, crusts, exudation and focal ulceration and draining tracts are observed with more advanced disease. Occasionally, nodules may be present.
Skin lesions often begin on the face and the forelegs and may progress to affect other body sites. Bilateral ceruminous otitis externa occasionally may be seen with demodicosis. Generalized demodicosis may be associated with lymphadenopathy, lethargy and fever. A secondary bacterial skin infection almost invariably accompanies generalized demodicosis. Pedal demodicosis may be associated with significant interdigital oedema and, particularly in larger dogs, may be distressingly painful.
Diagnosis of demodicosis
Deep skin scrapings
At this time, deep skin scrapings are the diagnostic test of choice in suspect cases. 31 Curettes, spatula, sharp and dull scalpel blades can all be used to collect samples. Placing a drop of mineral oil on the sampling instrument and/or directly on the skin site can be helpful because debris adheres better to the instrument. Multiple scrapings (approximately 1 cm 2 ) of affected skin are performed in the direction of the hair growth, and the skin should be squeezed during or between scrapings to extrude the mites from the deep follicles to the surface. Squeezing the skin has been shown to increase the number of mites found with the skin scrapings (COE III). 32 The best yield is achieved with primary lesions, such as follicular papules and pustules. Ulcerated areas should not be scraped because mite yields may be low in such areas. The skin is scraped until capillary bleeding occurs, which indicates that the scraping has reached sufficient depth. In a long- or medium-haired dog, gently clipping the area to be scraped will minimize the loss of the scraped material into the surrounding hair. Debris is then transferred to a slide, mixed with mineral or paraffin oil and examined with a coverslip under the microscope at low-power magnification (×4 and ×10 lens).
Although Demodex mites are part of the normal microfauna, it is uncommon to find one mite even on several deep skin scrapings. If a mite is found, this should raise suspicion and additional skin scrapings should be performed. Finding more than one mite is strongly suggestive of clinical demodicosis (COE V). 31 Different life stages (eggs, larvae, nymphs and adults) and their numbers should be recorded, compared from the same sites at each visit and used to evaluate response to treatment. Mites may be easier to find when the microscope condenser is lowered and the light decreased because this increases the contrast in the microscope field.
Trichograms
Trichograms have been reported as an alternative to deep skin scrapings 32,33 and are particularly useful in areas that are difficult to scrape, such as periocular and interdigital areas. Hairs from lesional skin are plucked with forceps in the direction of the hair growth and placed in a drop of mineral or paraffin oil on a slide (Figure 1). The use of a coverslip allows more thorough and rapid inspection of the specimen. To increase the chance of a positive trichogram, a large number of hairs (50–100) should be plucked. When performed properly, trichograms have a high diagnostic yield. However, negative trichograms should be followed by deep skin scrapings before ruling out demodicosis (COE III). Positive trichograms in healthy dogs are rare. 34
Photograph of a trichogram showing Demodex mites and eggs (arrows) in mineral oil (×100).
Skin biopsy
In some rare cases, skin scrapings and trichograms may be negative, and skin biopsies may be needed to detect the Demodex mites in the hair follicles or in foreign body granulomas in furunculosis. This may be more likely in certain body locations, such as the paws, and certain dog breeds, such as shar-peis.
Other methods of mite detection
Direct examination of the exudate from pustules or draining tracts may reveal mites in some dogs. Specimens can be collected by squeezing the exudate onto a glass slide and visualized by adding mineral oil or paraffin oil and a coverslip. In some cases where mites are very abundant, acetate tape preparations may also reveal mites. If affected dogs have lymphadenopathy, it is not uncommon to find mites on fine-needle aspirates. These methods cannot be used to rule out the presence of an infestation.
Identification of bacterial infections (using clinical signs, skin cytology and culture)
Frequently, generalized demodicosis is associated with secondary bacterial skin infections. In severe cases with furunculosis, bacterial septicaemia is possible. When clinical signs of a possible bacterial skin infection (e.g. papules, pustules) are present, an impression smear should be obtained, stained and evaluated for an increased number and/or intracellular location of bacterial organisms. Most commonly, Staphylococcus pseudintermedius will be present, 8 but in some dogs, particularly those with furunculosis, Gram-negative rods, such as Escherichia coli or Pseudomonas aeruginosa, may predominate.
Treatment of canine demodicosis
Treatment of canine generalized demodicosis is multimodal. In addition to effective acaricidal therapy, treatment of concurrent bacterial skin infection, internal parasitism and underlying systemic disease must be undertaken to maximize the potential for successful treatment (COE V).
Treatment of secondary bacterial skin infection
Cytology is essential in the evaluation of a dog with demodicosis (see identification of bacterial infections above). When an infection is present, it should be treated based on the standard of care in each country. It is beyond the scope of these guidelines to detail recommendations for antimicrobial therapy. Ideally, a bacterial culture should be performed to determine the choice of antibiotic. Culture and susceptibility testing are ideal in dogs with rod-shaped bacteria present on cytology, in cases with apparent bacterial resistance or in very severe, potentially life-threatening infection (COE V). If a culture is not possible, cytological determination of the bacterial type (rods or cocci) is essential prior to empirical antibiotic therapy, because many antibiotics empirically suited for Gram-positive coccal infections are ineffective for Gram-negative rods.
Appropriate oral antibiotic therapy and concurrent topical antimicrobial therapy (whole-body soaks or shampoos) are recommended for all dogs with generalized demodicosis and secondary bacterial skin infection (COE V). In addition to antimicrobial benefits, topical therapy contributes to the overall wellbeing of the dog by removing crusts and debris that may contain mites, exudate and inflammatory mediators. Benzoyl peroxide (2–3%) and chlorhexidine-based shampoos (3–4%) are commonly recommended for dogs with demodicosis. They have a prolonged antibacterial activity on skin. 35 Benzoyl peroxide is degreasing, thus drying, and may be irritant, so it may be prudent to follow up with a moisturizer to prevent drying of the skin. 36 The frequency of topical therapy depends on the dog, owner and concurrent miticidal therapy, but weekly bathing is most commonly recommended (COE V). Antimicrobial therapy should be continued for 1–2 weeks beyond clinical and microscopic resolution of the bacterial skin infection.
Amitraz as a rinse has been approved for the treatment of canine generalized demodicosis in many countries for decades. It has been shown to be an effective treatment option in many studies (COE I). 8 The recommended concentration varies from 0.025 to 0.06%, with a frequency of once weekly to every 2 weeks. 8 Clinical efficacy increases with increasing concentration and shorter treatment intervals (COE II). 37,38 Intensive protocols with daily rinsing of alternating body halves at a concentration of 0.125% 39 or weekly treatment with an amitraz concentration of 1.25% 37 have been reported in dogs not responding to conventional therapies. In the latter report, dogs were treated once with atipamezole (0.1 mg/kg intramuscularly) followed by oral yohimbine (0.1 mg/kg) once daily for 3 days to minimize systemic adverse effects. 37 These intensive protocols should be reserved for dogs failing routine treatment.
When using amitraz rinses, it is essential to clip the hair coat in dogs with medium to long hair coat (COE V). 40 This needs to be repeated as needed during the treatment course. The rinse should be applied carefully with a sponge and soaking the skin, and allowed to air dry without rinsing. Dogs should not be allowed to get wet between rinses, to avoid washing off the amitraz. Treatment of pedal demodicosis with amitraz rinses may be problematic in wet environments because it is difficult to maintain the amitraz on the pedal skin in these circumstances. Daily treatment of the paws 27 or using other treatment modalities may be needed (COE V). Adverse effects of amitraz reported in various studies were depression, sleepiness, ataxia, polyphagia, polydipsia, vomiting and diarrhoea. 8 Amitraz anecdotally has caused headaches and asthma in owners, thus it is commonly recommended that dogs should be washed in a well-ventilated area. 8,27,41
Based on published studies, amitraz rinses seem to be less efficacious in dogs with adult-onset demodicosis. 8 Weekly treatment is recommended (COE I). As approved concentrations and treatment interval vary from country to country, veterinarians need to choose the treatment protocol approved in their location based on their country’s regulatory agency guidelines.
More recently, a spot-on preparation with 15% amitraz and 15% metaflumizone has been used in some countries as a monthly treatment for canine demodicosis. Pilot studies showed promising results with administration monthly 42 and every 2 weeks. 42,43 However, pemphigus foliaceus-like drug reactions have been reported after the use of the spot-on, and some dogs required long-term immunosuppressive therapy for the treatment of this disease even after the use of spot-on was discontinued. 44 The manufacturer indicated that the production of this spot-on is discontinued in North America at the time of writing but apparently still sold in other parts of the world. Based on the reported cases of drug-induced pemphigus foliaceus, 44 this spot-on preparation should not be routinely used for the treatment of canine demodicosis, but should be reserved for cases not responding to other treatment options.
Macrocyclic lactones
Milbemycin oxime
Milbemycin oxime is licensed for the treatment of canine demodicosis in some countries at a dose of 0.5–2 mg/kg daily orally (p.o.). In studies from the USA and Australia, a clearly higher success rate was seen with a higher dose of 1–2 compared with 0.5–1 mg/kg. 25,26,41 This is in contrast to a Swedish study, where good results were achieved with the low-dose protocol, 45 possibly because most dogs in this study were diagnosed early in the disease and had not previously been treated with other miticides. In contrast, the other studies were conducted in referral practices with potentially more chronically and severely affected patients. Alternatively, a different genetic base of the dogs or different susceptibilitiy of the mites to milbemycin oxime may have influenced the results. The success rate of milbemycin oxime was shown to be much lower in dogs with adult-onset demodicosis (COE I). 25,45 Milbemycin oxime has been administered to collie dogs at a dose of 2.5 mg/kg daily for 10 days without adverse effects, 46 and there seems to be a high safety margin with this drug. 8 However, dogs homozygous for the ABCB1-Δ1 (MDR-1) mutation developed ataxia with milbemycin oxime at a dose of approximately 1.5 mg/kg daily, but tolerated the drug at 0.6 mg/kg/day. 47
At this time, milbemycin oxime is recommended for the treatment of canine generalized demodicosis at a dose of 1–2 mg/kg p.o. daily. A lower efficacy is seen with adult-onset demodicosis (COE I). In herding breed dogs, it is advised to evaluate the ABCB1-Δ1 (MDR-1) genotype and to use lower doses or increase the dose gradually in dogs homozygous for the ABCB1-Δ1 (MDR-1) mutation (COE V).
Ivermectin
Ivermectin is not licensed for use in canine demodicosis. It has been used as weekly injection at a dose of 0.4 mg/kg subcutaneously (s.c.) with variable and inconsistent results. 48 Thus, injectable weekly treatment cannot be recommended at this time for the treatment of canine generalized demodicosis (COE III). However, there are a number of studies evaluating daily oral ivermectin at a concentration of 0.3–0.6 mg/kg with similar outcome measures and treatment success. 29,49–53 An evidence-based review concluded that oral ivermectin at a dose of 0.3–0.6 mg/kg daily can be recommended as therapy for canine generalized demodicosis (COE I). 8 Ivermectin can cause severe neurological adverse effects, such as lethargy, tremors, mydriasis and death in sensitive dogs (COE I). Anecdotally, blindness has also been seen. Collie dogs and other herding breeds are most commonly affected, but other breeds have also been reported. 54 Thus, a gradual dose increase from 0.05 mg/kg on day 1 to 0.1 mg/kg on day 2, 0.15 mg/kg on day 3, 0.2 mg/kg on day 4 and 0.3 mg/kg on day 5 is recommended in any dog treated with ivermectin (COE III). 54 When higher daily doses are used then a further increase by 0.1 mg/kg/day is recommended. Other P-glycoprotein inhibitors, such as ketoconazole or ciclosporin, if given concurrently, increase the likelihood of adverse effects (COE III). 55,56
More recently, an ABCB1-Δ1 (MDR-1) mutation considered responsible for the acute toxicity in collie dogs and several other herding breeds has been identified. 57–59 Testing for this defect is possible. However, in a recent study evaluating 28 ‘nonsensitive’ breed dogs with neurological adverse effects to daily ivermectin after 4 days to 5 weeks of therapy, 60 27 dogs did not show an alteration of the ABCB1-Δ1 (MDR-1) gene, thus other mechanisms of toxicity must exist. Based on published studies, ivermectin at 0.3–0.6 mg/kg p.o. daily is an effective therapy for canine demodicosis (COE I), but the dose needs to be gradually increased (COE III) and dogs monitored for adverse effects. If such adverse effects occur, ivermectin administration should be discontinued. In some cases, it may be indicated to attempt administering a lower dose of ivermectin; if this is successful and clinical signs of toxicity resolve, therapy may be continued at the lower dose. This approach is not recommended in dogs with acute toxicity within days of beginning treatment, but is often effective in dogs developing adverse effects after some weeks of therapy (COE V). Dogs of breeds known to be at risk should be tested for the ABCB1-Δ1 gene mutation (where this is possible) or receive alternative treatments.
Moxidectin
Moxidectin has been used in a number of studies at doses of 0.2–0.5 mg/kg/day p.o. with comparable success to ivermectin. 53,61–63 Adverse effects are similar to those of ivermectin, 8 and a gradual dose increase similar to that described for ivermectin was used in two of the studies. 62,63 However, adverse effects are more common. In one study, treatment was discontinued due to lethargy, vomiting and ataxia in three of 22 dogs. In one dog, adverse effects were noted at a dose of 0.28 mg/kg and in the other two dogs it occurred at 0.4 mg/kg. In another study, adverse effects were seen in 12 of 35 dogs treated with moxidectin at 0.5 mg/kg every 72 h. The most common adverse effects were vomiting and inappetence, but these were not severe enough to warrant discontinuation of therapy.
Based on the published evidence, moxidectin at 0.2–0.5 mg/kg p.o. daily can be recommended as an effective therapy for canine demodicosis (COE I); an initial gradual dose increase and careful monitoring are recommended, similar to oral ivermectin.
Moxidectin has also become available as a 2.5% spot-on formulation (in combination with 10% imidacloprid). Initial studies evaluating the spot-on as monthly treatment for generalized demodicosis were encouraging. 64 However, clinical use did not corroborate the findings, and subsequent studies revealed that the spot-on was more efficacious in juvenile dogs with milder forms of the disease 30 and that weekly therapy showed better results than twice monthly or monthly administration. 9,65 Based on these results, the label of this product was changed to recommend weekly administration in many countries where it has been approved for the treatment of canine demodicosis. Currently, the spot-on containing 2.5% moxidectin and 10% imidacloprid can be recommended as weekly treatment for dogs with juvenile-onset and mild forms of the disease (COE II). If significant improvement is not seen within the first few weeks, other therapy may be indicated.
Doramectin
Doramectin is also a macrocyclic lactone that has been reported as a successful treatment for canine demodicosis. 66,67 In one study, it was administered at 0.6 mg/kg s.c. weekly; 66 in the second study, it was administered at the same dose p.o. once weekly. 67 In the latter study, two dogs that did not improve clinically responded to 0.6 mg/kg p.o. twice weekly, but one of them, a golden retriever, developed ataxia and subsequently was treated twice weekly with 0.3 mg/kg doramectin. The recurrence rate was higher in dogs with adult-onset disease (as seen with amitraz and milbemycin oxime; COE III). Based on these two studies, there is evidence that doramectin at a dose of 0.6 mg/kg p.o. or s.c. weekly may be used for the treatment of demodicosis (COE III).
The question of whether more frequent administration increases the success rate without unacceptable adverse effects has to be evaluated by further, preferably by randomized blinded trials. The effect of 1 mg/kg doramectin on Ancylostoma caninum and Toxocara canis has been evaluated in pregnant beagle bitches, and no adverse effects were seen. 68,69 Likewise, beagle dogs were treated with 0.4 mg/kg s.c. doramectin for Spirocerca lupi with no adverse effects. 70 However, subcutaneous doramectin at 0.2 and 0.7 mg/kg, respectively, caused severe neurological signs in a collie dog 71 and two white Swiss German shepherd dogs with an MDR-1 mutation 72 approximately 24 h after a single administration; thus it is recommended to gradually increase the doramectin dose to identify drug-sensitive dogs in a similar manner to the recommendations for ivermectin and moxidectin.
Other treatment options
In addition to various medical treatments, it seems prudent, based on published information, to recommend good control of endoparasites, a balanced, high-quality diet and avoidance of immunosuppressive treatments if at all possible (COE V).
There are a number of other reports evaluating various treatments, most of which are summarized in a published review. 8 A recently published study showed that treatment with selamectin at a dose of 24–48 mg/kg p.o. once weekly or twice monthly had a low success rate in canine generalized demodicosis (COE III). 10
There is insufficient evidence to recommend treatment of canine demodicosis with amitraz collars, closantel, deltamethrin, vitamin E, herbal and homeopathic preparations, muramyl dipeptide and phoxime. 8 There is evidence against the use of pour-on or injectable weekly ivermectin, lufenuron, ronnel, oral selamectin and levamisole (COE III). 8,10
Treatment duration, monitoring and prognosis
It is not sufficient to rely on clinical appearance as the end-point of treatment. Clinically normal dogs may still harbour mites on skin scrapings. Microscopic cure, defined as multiple negative skin scrapings, in addition to resolution of clinical signs is needed to determine the therapeutic end-point. In general, it is recommended to scrape repeatedly the three to five most severely affected areas and any new lesions monthly until all three to five scrapings are negative. As only small areas are scraped, which may not be representative of the dog as a whole, it is recommended to continue treatment for 1 month after the second negative monthly set of skin scrapings. In dogs that responded very slowly to therapy, extend treatment even further (COE V).
The prognosis for canine demodicosis is good, with the majority of cases achieving long-term remission. 8 However, dogs with a incurable or poorly controlled underlying disease may never be cured and may require long-term therapy (e.g. monthly amitraz rinses or weekly ivermectin administration). Development of Demodex mite resistance against miticides has not been documented at this point to the authors’ knowledge. Whether low-dose long-term glucocorticoid therapy for allergic disease is sufficient immunosuppression to trigger generalized demodicosis has not been evaluated to the authors’ knowledge. The current recommendation is to avoid long-term glucocorticoid therapy in dogs with a history of demodicosis (COE V).
Based on published studies, a recurrence of the disease in the first 1–2 years after cessation of therapy does occur in a small number of dogs. 8 The majority of these cases achieve remission with a repeat of the same treatment regimen or with another type of therapy. 8 In more recent studies, a follow-up period of 12 months is recommended to monitor for relapse. It is recommended to monitor dogs closely for recurrence of clinical disease during the first 12 months after treatment has been discontinued.
How should dogs with adult-onset demodicosis be evaluated for underlying diseases?
Adult-onset demodicosis is defined as the development of demodicosis in an adult dog with no known prior history of the disease. In adult animals, immunosuppressive therapy and diseases such as neoplasms, hypothyroidism or hyperadrenocorticism have been reported to be associated with generalized demodicosis. 23–25 Evaluation for an underlying disease may include, but not be limited to, the following tests: a complete blood count, biochemistry panel and urinalysis, lymph node aspirate, radiographs of the chest and ultrasound of the abdomen.
Hyperadrenocorticism and hypothyroidism should be investigated; if there are no other supporting signs of hormonal diseases, urine cortisol creatinine ratio may be used to rule out hyperadrenocorticism (COE V). Evaluation of thyroid hormone concentrations can be difficult. Chronic stress due to generalized demodicosis and secondary deep bacterial skin infection may influence results of these tests. Thyroxine concentrations may be decreased due to euthyroid sick syndrome, and the urine cortisol creatinine ratio may be increased. Depending on the individual case situation, veterinarians need to consider postponing diagnostic tests for hormonal disease until the bacterial skin infection is treated and the demodicosis is improved or in remission. If owners of dogs showing no other clinical signs of disease refuse further diagnostic evaluation, close monitoring of the dog until development of further clinical clues should be recommended (COE V). If systemic signs point to a particular disease, that disease should be confirmed and treated, as evidence shows that successful treatment of an underlying cause may contribute to remission of the demodicosis (COE IV). 15
Should dogs with demodicosis be allowed to breed?
Demodicosis in young dogs is most likely to be based on one or more genetic traits, as supported by strong breed predispositions 73 and the fact that selective breeding has decreased the incidence of demodicosis in breeding kennels. 27 To prevent an increase in prevalence of canine demodicosis, it is recommended not to breed from any dog with generalized demodicosis 27,74 and to neuter affected animals. This is especially important in the bitch, as oestrus cycles may trigger recurrence of clinical disease (COE III), 75 providing a further argument for neutering these animals.
Almost 30 years ago, the American Academy of Veterinary Dermatology recommended that ‘the AAVD urges veterinarians to accept for therapy only those generalized demodicosis patients who have been or will be neutered’. 76 However, the definition of generalized demodicosis is subjective and thus this recommendation may lead to different outcomes with different breeders and veterinarians. The reported lesion extent consistent with localized disease ranges from four lesions to 50% of the body surface. 29,30 There is little information on the measured lesional area that is considered localized and whether the size of a lesion considered localized is influenced by the size of the dog. It is also not known whether an area with papules, pustules, exudation, crusting and ulcers is comparable to an area characterized by alopecia and comedones only. Thus, the authors consider that differentiation is only of limited help to the practitioner. In addition, it is unclear whether treatment of localized demodicosis will prevent the disease from becoming generalized, or if a dog predisposed to generalized demodicosis would develop it even if topical treatment were used initially on the first localized lesions. Studies to answer these questions are urgently needed. The main reasons for differentiating the two forms are the prognosis and the decision about neutering the dog to prevent breeding.
Currently, the consensus of this committee is as follows. As there is no scientific basis for a clear and consistent differentiation between localized and generalized demodicosis, ideally all dogs with demodicosis should be eliminated from the breeding pool. As this is not a realistic outlook for many breeds, breeding recommendations should be based on the need for specifically treating the dog for demodicosis. In a dog with clinical signs of demodicosis limited to one or few areas of the body and not affecting the general wellbeing of the dog, it is acceptable to use antimicrobial shampoos only and refrain from mite-specific therapies. However, if the disease continues to progress such that specific miticidal treatment is required, neutering the animal to prevent breeding is strongly recommended (COE V).
Problem no. 1: treatment of localized demodicosis
Case scenario no. 1
A 6-month-old female West Highland white terrier was presented with three small areas, approximately 5 cm 2 , of alopecia (Figure 2). Scrapings show numerous adult Demodex mites, larvae and eggs.
Photograph of the trunk of a 6-month-old West Highland white terrier with localized demodicosis. Note the focal alopecia, erythema, papules and small ulcers and crusts.
Scenario 1a: the alopecic areas are slightly scaly with a few comedones.
Scenario 1b: papules, pustules and crusts are prominent in the alopecic areas.
Treatment options for scenario 1a:
- 1 This dog would qualify for localized demodicosis. Thus, initially simple monitoring of the dog for further progression to generalized disease or spontaneous remission is the recommended option.
- 2 If the owner desires therapy, topical antiseptic shampoos (e.g. benzoyl peroxide or chlorhexidine) are recommended once to twice weekly (COE V). Benzoyl peroxide is a degreasing and thus drying shampoo and may need to be followed up with a moisturizer to prevent dry, scaly and pruritic skin.
Treatment options for scenario 1b:
- 1 This dog would still qualify for localized demodicosis. Thus, initially simple monitoring of the dog for further progression to generalized disease or spontaneous remission is a possible option. However, the papules and crusts indicate a possible bacterial secondary infection, and an impression smear is indicated to look for the presence of bacteria. The ideal method is an aspiration of an intact pustule. Alternatively, an impression smear can be obtained after rupturing a pustule. Topical antiseptic shampoos (e.g. containing benzoyl peroxide or chlorhexidine) should be recommended once to twice weekly (COE V).
- 2 If, in addition to the presence of inflammatory cells, there is a large number of intra- and/or extracellular bacteria, an oral antibiotic may be required. Oral antibiotic therapy should ideally be selected based on bacterial culture and susceptibility, particularly if the dog has been previously treated with antibiotics. Alternatively, topical antiseptic therapy can be used as frequently as daily or every other day.
Problem no. 2: treatment of generalized demodicosis
Case scenario no. 2
A 6-month-old male pug is presented with generalized hypotrichosis, scaling and multifocal areas of alopecia and erythema.
Scenario 2a: the alopecic areas are scaly and erythematous with a few comedones.
Scenario 2b: papules, pustules, crusts and copious exudation are prominent in the alopecic areas. An exudative pododermatitis is also present. The dog shows lethargy and an increased body temperature (Figures 3 and 4).
Photograph of the face of a 6-month-old pug with demodicosis. Severe alopecia, erythema, erosions, ulcers and crusts can be seen.
Photograph of the preputial area of the pug from Figure 3. Alopecia, erythema, papules, pustules and crusts are present.
Treatment options for scenario 2a:
- 1 Cytology and culture of skin lesions should determine whether oral antibiotic therapy is needed. Even without evidence of an active infection, topical antibacterial therapy is indicated to minimize the chance of a secondary bacterial skin infection developing.
- 2 Miticidal therapy is indicated. Topical moxidectin weekly is a convenient and safe treatment option that can be recommended for this dog (COE II). Other alternatives are amitraz rinses weekly or every 2 weeks, oral daily milbemycin oxime, ivermectin or moxidectin (initially in gradually increasing doses; COE I) or weekly doramectin (COE III). Treatment should be chosen based on the legal conditions in the respective countries.
- 3 Monthly skin scrapings should be performed and treatment changed if either clinical signs and/or mite numbers on skin scrapings have not improved from the last visit. Once clinical and, most importantly, microscopic remission have been achieved, treatment should ideally be continued for a further 4–8 weeks (COE V).
- 4 Close monitoring of dogs for recurrence is recommended, particularly during the first 12 months of remission.
- 5 Long-term glucocorticoid therapy or other immunosuppression should be avoided, if at all possible (COE V).
Treatment options for scenario 2b:
- 1 The situation may require administration of empirical antibiotic therapy pending culture and susceptibility results. Cytology should determine which kind of antibacterial agent has the highest empirical value. Ideally, an aspirate should be taken from an intact pustule for culture and sensitivity testing before empirical antibiotic therapy is begun, and a complete blood count and biochemistry panel should be obtained. Hospitalization of the dog and administration of intravenous fluid and antibiotics may be considered based on the clinical condition of the dog and initial laboratory investigation. Once culture results are known, antibiotic therapy may have to be adjusted. Antimicrobial therapy should be continued for 1–2 weeks after clinical and microscopic resolution of the bacterial skin infection (COE V).
- 2 Topical antibacterial therapy is indicated to remove bacteria, crusts and inflammatory mediators from the skin surface (COE V). In some severely affected dogs, it may be necessary to delay topical therapy until the dog’s systemic signs have improved and the stress of bathing is more easily tolerated.
- 3 Miticidal therapy is indicated. Topical amitraz rinses, milbemycin oxime at high doses, oral ivermectin or moxidectin (in gradually increasing doses; COE I) or weekly doramectin (COE III) may all be considered based on the legal situation.
- 4 Initially, the dog ideally should be evaluated weekly until lethargy and increased body temperature have resolved. Treatment changes should be considered if neither clinical signs nor mite numbers on skin scrapings have changed after a month. Thereafter, monthly skin scrapings are indicated. Once clinical and microscopic remission have been achieved, treatment should ideally be continued for a further 4–8 weeks (COE V).
- 5 Close monitoring of dogs for recurrence is recommended, particularly during the first 12 months of remission.
- 6 Long-term glucocorticoid therapy or other immunosuppression should be avoided, if at all possible (COE V).
Acknowledgements
The authors would like to thank the involved presidents and board members of the many professional organizations for their time to review these guidelines and their support. They are grateful for Kinga Gortel’s helpful suggestions regarding the manuscript.
Appendices
Appendix 1: Summarized treatment of canine demodicosis
Treatment of a dog with localized and mild to moderate disease
- 1 Use topical therapy with chlorhexidine or benzoyl peroxide shampoo weekly.
- 2 Monitor the disease progression. Many dogs will show resolution of clinical signs. Dogs with deteriorating disease should be treated as described below.
Treatment of a dog with severe generalized disease
- 1 Perform cytology and (with evidence of secondary bacterial skin infection) ideally a bacterial culture and sensitivity. With inflammatory cells and bacteria present, appropriate oral antibiotic therapy is recommended.
- 2 Use topical therapy with chlorhexidine or benzoyl peroxide shampoo weekly to possibly twice weekly.
- 3 Several options exist for the treatment of the Demodex mites and which option is best will depend on the legalities pertaining to the use of veterinary pharmaceutical products in the country of residence, the finances of the owner and the clinical situation. However, independent of the treatment specifics the dog should be neutered because dogs in need of mite treatment should not be alllowed to breed, and the disease may relapse in cycling bitches.
- a Amitraz weekly or every 2 weeks in a concentration of 0.025–0.06% can be used. Dogs with a mid to long hair coat need to be clipped, and skin should stay dry between rinses to avoid washing off the drug. Rinsing should be performed in well-ventilated areas.
- b Milbemycin oxime may be administered orally at a dose of 1–2 mg/kg/day.
- c Moxidectin as a spot-on in combination with imidacloprid may be used weekly. This spot-on formulation has a markedly higher success rate in dogs with milder disease.
- d Ivermectin at a dose of 0.3–0.6 mg/kg or moxidectin at 0.2–0.5 mg/kg p.o. daily are further options. With both drugs, a gradual increase from an initial dose of 0.05 mg/kg to the final dose within a few days is recommended to identify dogs that cannot tolerate those drugs. Monitoring for neurological adverse effects should occur throughout the course of therapy.
- e Doramectin weekly at 0.6 mg/kg p.o. or s.c. is a possible treatment. A gradual increase from an initial dose of 0.1 mg/kg to the final dose seems prudent to identify dogs that cannot tolerate the drug and will show neurological adverse effects.
- f Dogs should be evaluated monthly, and treatment should be continued beyond negative skin scrapings.
- g Factors predisposing to demodicosis, such as malnutrition, endoparasites, endocrine disease, neoplasias and chemotherapy, should be identified and corrected to maximize response to therapy.
Article Information
Format Available
© 2012 The Authors. Veterinary Dermatology. © 2012 ESVD and ACVD
Publication History
- Issue online: 12 March 2012
- Version of record online: 13 February 2012
- Accepted 24 October 2011
Supporting Information
Folder S1. Translations of the paper ‘Treatment of demodicosis in dogs: 2011 clinical practice guidelines’.
Please note: Wiley-Blackwell is not responsible for the content or functionality of any supporting information supplied by the authors. Any queries (other than missing content) should be directed to the corresponding author for the article.
References
- 1 Olivry T , Mueller RS . Evidence-based veterinary dermatology: a systematic review of the pharmacotherapy of canine atopic dermatitis . Veterinary Dermatology 2003 ; 14 : 121 – 146 .
- Wiley Online Library |
- PubMed |
- CAS |
- Web of Science® Times Cited: 107
- 2 Olivry T , Foster AP , Mueller RS et al. Interventions for atopic dermatitis in dogs: a systematic review of randomized controlled trials . Veterinary Dermatology 2010 ; 21 : 4 – 22 .
- Wiley Online Library |
- PubMed |
- Web of Science® Times Cited: 49
- 3 Olivry T , DeBoer DJ , Favrot C et al. Treatment of canine atopic dermatitis: 2010 clinical practice guidelines from the International Task Force on Canine Atopic Dermatitis . Veterinary Dermatology 2010 ; 21 : 233 – 248 .
- Wiley Online Library |
- PubMed |
- Web of Science® Times Cited: 63
- 4 Moriello KA . Treatment of dermatophytosis in dogs and cats: review of published studies . Veterinary Dermatology 2004 ; 15 : 99 – 107 .
- Wiley Online Library |
- PubMed |
- Web of Science® Times Cited: 53
- 5 Nuttall T , Cole LK . Evidence-based veterinary dermatology: a systematic review of interventions for treatment of Pseudomonas otitis in dogs . Veterinary Dermatology 2007 ; 18 : 69 – 77 .
- Wiley Online Library |
- PubMed |
- Web of Science® Times Cited: 17
- 6 Noli C , Auxilia ST . Treatment of canine Old World visceral leishmaniasis: a systematic review . Veterinary Dermatology 2005 ; 16 : 213 – 232 .
- Wiley Online Library |
- PubMed |
- Web of Science® Times Cited: 81
- 7 Leung DY , Nicklas RA , Li JT et al. Disease management of atopic dermatitis: an updated practice parameter. Joint Task Force on Practice Parameters . Annals of Allergy, Asthma & Immunology 2004 ; 93 : S1 – S21 .
- CrossRef |
- PubMed |
- Web of Science® Times Cited: 55
- 8 Mueller RS . Treatment protocols for demodicosis: an evidence-based review . Veterinary Dermatology 2004 ; 15 : 75 – 89 .
- Wiley Online Library |
- PubMed |
- Web of Science® Times Cited: 73
- 9 Paterson TE , Halliwell RE , Fields PJ et al. Treatment of canine-generalized demodicosis: a blind, randomized clinical trial comparing the efficacy of Advocate ® (Bayer Animal Health) with ivermectin . Veterinary Dermatology 2009 ; 20 : 447 – 455 .
- Wiley Online Library |
- PubMed |
- Web of Science® Times Cited: 13
- 10 Schnabl B , Bettenay S , Glos N et al. Oral selamectin in the treatment of canine generalised demodicosis . Veterinary Record 2010 ; 166 : 710 – 714 .
- CrossRef |
- PubMed |
- CAS |
- Web of Science® Times Cited: 4
- 11 Henpf Olschewski C . Hat Jeder Hautgesunde Hund Demodexmilben? Histologische Untersuchungen von Hautproben . Berlin: Freie Universität, 1988 ; 141.
- 12 Greve JH , Gaafar SM . Natural transmission of Demodex canis in dogs . Journal of the American Veterinary Medical Association 1966 ; 148 : 1043 – 1045 .
- PubMed |
- CAS |
- Web of Science® Times Cited: 32
- 13 Chesney CJ . Short form of Demodex species mite in the dog: occurrence and measurements . Journal of Small Animal Practice 1999 ; 40 : 58 – 61 .
- Wiley Online Library |
- PubMed |
- CAS |
- Web of Science® Times Cited: 30
- 14 Desch CE , Hillier A . Demodex injai: a new species of hair follicle mite (Acari: Demodecidae) from the domestic dog (Canidae) . Journal of Medical Entomology 2003 ; 40 : 146 – 149 .
- CrossRef |
- PubMed |
- Web of Science® Times Cited: 30
- 15 Hillier A , Desch CE . Large-bodied Demodex mite infestation in 4 dogs . Journal of the American Veterinary Medical Association 2002 ; 220 : 623 – 627 , 613.
- CrossRef |
- PubMed |
- Web of Science® Times Cited: 24
- 16 Mueller RS , Bettenay SV . An unusual presentation of generalised demodicosis caused by a long-bodied demodex mite in a Lakeland Terrier . Australian Veterinary Practitioner 1999 ; 29 : 128 – 131 .
- Web of Science® Times Cited: 14
- 17 Ordeix L , Bardagi M , Scarampella F et al.Demodex injai infestation and dorsal greasy skin and hair in eight wirehaired fox terrier dogs . Veterinary Dermatology 2009 ; 20 : 267 – 272 .
- Wiley Online Library |
- PubMed |
- Web of Science® Times Cited: 12
- 18 Robson DC , Burton GG , Bassett R et al. Eight cases of demodicosis caused by a long-bodied Demodex species (1997–2002) . Australian Veterinary Practice 2003 ; 33 : 64 – 72 .
- Web of Science® Times Cited: 10
- 19 Chen C . A short-tailed demodectic mite and Demodex canis infestation in a Chihuahua dog . Veterinary Dermatology 1995 ; 6 : 227 – 229 .
- Wiley Online Library |
- Web of Science® Times Cited: 24
- 20 Saridomichelakis M , Koutinas A , Papadogiannakis E et al. Adult-onset demodicosis in two dogs due to Demodex canis and a short-tailed demodectic mite . Journal of Small Animal Practice 1999 ; 40 : 529 – 532 .
- Wiley Online Library |
- PubMed |
- CAS |
- Web of Science® Times Cited: 18
- 21 Bourdeau P . Variation in size in Demodex canis: from the longest to the shortest forms . Veterinary Dermatology 2010 ; 21 : 213 (Abstract).
- 22 Plant JD , Lund EM , Yang M . A case–control study of the risk factors for canine juvenile-onset generalized demodicosis in the USA . Veterinary Dermatology 2011 ; 22 : 95 – 99 .
- Wiley Online Library |
- PubMed |
- Web of Science® Times Cited: 10
- 23 Duclos DD , Jeffers JG , Shanley KJ . Prognosis for treatment of adult-onset demodicosis in dogs: 34 cases (1979–1990) . Journal of the American Veterinary Medical Association 1994 ; 204 : 616 – 619 .
- PubMed |
- CAS |
- Web of Science® Times Cited: 47
- 24 Lemarie S , Hosgood G , Foil CS . A retrospective study of juvenile- and adult-onset generalized demodicosis in dogs (1986–1991) . Veterinary Dermatology 1996 ; 7 : 3 – 10 .
- Wiley Online Library |
- Web of Science® Times Cited: 21
- 25 Miller WH Jr , Scott DW , Wellington JR et al. Clinical efficacy of milbemycin oxime in the treatment of generalized demodicosis in adult dogs . Journal of the American Veterinary Medical Association 1993 ; 203 : 1426 – 1429 .
- PubMed |
- Web of Science® Times Cited: 37
- 26 Garfield RA , Lloyd R . The use of oral milbemycin oxime (Interceptor) in the treatment of chronic generalized canine demodicosis . Veterinary Dermatology 1992 ; 3 : 231 – 235 .
- Wiley Online Library
- 27 Scott DW , Miller WH Jr , Griffin CE . Canine demodicosis. Muller & Kirk’s Small Animal Dermatology . Philadelphia, W.B. Saunders, 2001 : 457 – 474 .
- 28 Bruzinska-Schmidhalter R , Nett-Mettler CS . Spontaneous remission in canine generalized demodicosis – predisposing factors . Veterinary Dermatology 2011 ; 22 : 301 (Abstract).
- 29 Fondati A . Efficacy of daily oral ivermectin in the treatment of 10 cases of generalized demodicosis . Veterinary Dermatology 1996 ; 7 : 99 – 104 .
- Wiley Online Library |
- Web of Science® Times Cited: 30
- 30 Mueller RS , Meyer D , Bensignor E et al. Treatment of canine generalized demodicosis with a ‘spot-on’ formulation containing 10% moxidectin and 2.5% imidacloprid (Advocate ® , Bayer Healthcare) . Veterinary Dermatology 2009 ; 20 : 441 – 446 .
- Wiley Online Library |
- PubMed |
- Web of Science® Times Cited: 10
- 31 Mueller RS , Bettenay SV . Skin scrapings and skin biopsies . In: Ettinger SJ , Feldman EC , eds. Textbook of Veterinary Internal Medicine . Philadelphia, W.B. Saunders, 2010 ; 368 – 371 .
- 32 Beco L , Fontaine F , Bergvall K et al. Comparison of skin scrapes and hair plucks for detecting Demodex mites in canine demodicosis, a multicentre, prospective study . Veterinary Dermatology , 2007 ; 18 : 381 (Abstract).
- 33 Bensignor E . Comparaison de trois techniques diagnostiques de demodecie a Demodex canis chez le chien . Pratique Medicale and Chirurgicale de l’Animal de Compagnie 2003 ; 38 : 167 – 171 .
- Web of Science® Times Cited: 3
- 34 Fondati A , De LuciaM , Furiani N et al. Prevalence of Demodex canis-positive healthy dogs at trichoscopic examination . Veterinary Dermatology 2010 ; 21 : 146 – 151 .
- Wiley Online Library |
- PubMed |
- Web of Science® Times Cited: 6
- 35 Kwochka KW , Kowalski JJ . Prophylactic efficacy of four antibacterial shampoos against Staphylococcus intermedius in dogs . American Journal of Veterinary Research 1991 ; 52 : 115 – 118 .
- PubMed |
- CAS |
- Web of Science® Times Cited: 24
- 36 Mueller RS . Topical dermatological therapy . In: Maddison JE , Page SW , Church DB , eds. Small Animal Pharmacology . Philadelphia, W.B. Saunders, 2008 ; 546 – 556 .
- CrossRef
- 37 Hugnet C , Bruchon-Hugnet C , Royer H et al. Efficacy of 1.25% amitraz solution in the treatment of generalized demodicosis (eight cases) and sarcoptic mange (five cases) in dogs . Veterinary Dermatology 2001 ; 12 : 89 – 92 .
- Wiley Online Library |
- PubMed |
- CAS |
- Web of Science® Times Cited: 12
- 38 Kwochka KW , Kunkle GA , Foil CS . The efficacy of amitraz for generalized demodicosis in dogs: a study of two concentrations and frequencies of application . The Compendium on Continuing Education for the Practising Veterinarian 1985 ; 7 : 8 – 17 .
- Web of Science® Times Cited: 38
- 39 Medleau L , Willemse T . Efficacy of daily amitraz therapy for refractory, generalized demodicosis in dogs: two independent studies . Journal of the American Animal Hospital Association 1995 ; 31 : 246 – 249 .
- CrossRef |
- PubMed |
- CAS |
- Web of Science® Times Cited: 15
- 40 Muller GH . Amitraz treatment of demodicosis . Journal of the American Animal Hospital Association 1983 ; 19 : 435 – 441 .
- Web of Science® Times Cited: 47
- 41 Mueller RS , Bettenay SV . Milbemycin oxime in the treatment of canine demodicosis . Australian Veterinary Practitioner 1995 ; 25 : 122 – 126 .
- Web of Science® Times Cited: 13
- 42 Fourie LJ , Kok DJ , du Plessis A et al. Efficacy of a novel formulation of metaflumizone plus amitraz for the treatment of demodectic mange in dogs . Veterinary Parasitology 2007 ; 150 : 268 – 274 .
- CrossRef |
- PubMed |
- CAS |
- Web of Science® Times Cited: 11
- 43 Rosenkrantz W . Efficacy of metaflumizone plus amitraz for the treatment of juvenile and adult onset demodicosis in dogs: pilot study of 24 dogs . Veterinary Dermatology 2009 ; 20 : 227 (Abstract).
- 44 Oberkirchner U , Linder K , Dunston S et al. Metaflumizone–amitraz (Promeris)-associated pustular acantholytic dermatitis in 22 dogs: evidence suggests contact drug-triggered pemphigus foliaceus . Veterinary Dermatology 2011 ; 22 : 436 – 448 .
- Wiley Online Library |
- PubMed |
- Web of Science® Times Cited: 9
- 45 Holm BR . Efficacy of milbemycin oxime in the treatment of canine generalized demodicosis: a retrospective study of 99 dogs (1995–2000) . Veterinary Dermatology 2003 ; 14 : 189 – 195 .
- Wiley Online Library |
- PubMed |
- Web of Science® Times Cited: 17
- 46 Sasaki Y , Kitagawa H , Murase S . Susceptibility of rough-coated collies to milbemycin oxime . Japanese Journal of Veterinary Science 1990 ; 52 : 1269 – 1271 .
- CrossRef |
- PubMed |
- CAS |
- Web of Science® Times Cited: 12
- 47 Barbet JL , Snook T , Gay JM et al.ABCB1-1Δ (MDR1-1Δ) genotype is associated with adverse reactions in dogs treated with milbemycin oxime for generalized demodicosis . Veterinary Dermatology 2009 ; 20 : 111 – 114 .
- Wiley Online Library |
- PubMed |
- Web of Science® Times Cited: 12
- 48 Scott DW , Walton DK . Experiences with the use of amitraz and ivermectin for the treatment of generalized demodicosis in dogs . Journal of the American Animal Hospital Association 1985 ; 21 : 535 – 541 .
- Web of Science® Times Cited: 29
- 49 Ristic Z , Medleau L , Paradis M et al. Ivermectin for treatment of generalized demodicosis in dogs . Journal of the American Veterinary Medical Association 1995 ; 207 : 1308 – 1310 .
- PubMed |
- CAS |
- Web of Science® Times Cited: 44
- 50 Guaguere E . Traitement de la demodecie generalisee du chien par l’ivermectine: a propos de 20 cas . Pratique Medicale et Chirurgicale de l’Animal de Compagnie 1996 ; 31 : 31 – 40 .
- 51 Medleau L , Ristic Z , McElveen DR . Daily ivermectin for the treatment of generalized demodicosis in dogs . Veterinary Dermatology 1996 ; 7 : 209 – 212 .
- Wiley Online Library |
- Web of Science® Times Cited: 28
- 52 Mueller RS , Hastie K , Bettenay SV . Daily oral ivermectin for the treatment of generalised demodicosis in 23 dogs . Australian Veterinary Practitioner 1999 ; 29 : 132 – 136 .
- Web of Science® Times Cited: 15
- 53 Delayte EH , Otsuka M , Larsson CE et al. Efficacy of systemic macrocyclic lactones (ivermectin and moxidectin) for the treatment of generalized canine demodicosis . Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia 2006 ; 58 : 31 – 38 .
- CrossRef |
- CAS |
- Web of Science® Times Cited: 7
- 54 Mueller RS , Bettenay SV . A proposed new therapeutic protocol for the treatment of canine mange with ivermectin . Journal of the American Animal Hospital Association 1999 ; 35 : 77 – 80 .
- CrossRef |
- PubMed |
- CAS |
- Web of Science® Times Cited: 19
- 55 Hugnet C , Lespine A , Alvinerie M . Multiple oral dosing of ketoconazole increases dog exposure to ivermectin . Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2007 ; 10 : 311 – 318 .
- PubMed |
- CAS |
- Web of Science® Times Cited: 30
- 56 Mayer UK , Glos K , Schmid M et al. Adverse effects of ketoconazole in dogs – a retrospective study . Veterinary Dermatology 2008 ; 19 : 199 – 208 .
- Wiley Online Library |
- PubMed |
- Web of Science® Times Cited: 13
- 57 Mealey KL , Bentjen SA , Gay JM et al. Ivermectin sensitivity in collies is associated with a deletion mutation of the mdr1 gene . Pharmacogenetics 2001 ; 11 : 727 – 733 .
- CrossRef |
- PubMed |
- CAS |
- Web of Science® Times Cited: 207
- 58 Mealey KL , Meurs KM . Breed distribution of the ABCB1-1Δ (multidrug sensitivity) polymorphism among dogs undergoing ABCB1 genotyping . Journal of the American Veterinary Medical Association 2008 ; 233 : 921 – 924 .
- CrossRef |
- PubMed |
- Web of Science® Times Cited: 27
- 59 Roulet A , Puel O , Gesta S et al. MDR1-deficient genotype in Collie dogs hypersensitive to the P-glycoprotein substrate ivermectin . European Journal of Pharmacology 2003 ; 460 : 85 – 91 .
- CrossRef |
- PubMed |
- CAS |
- Web of Science® Times Cited: 91
- 60 Bissonnette S , Paradis M , Daneau I et al. The ABCB1-1Δ mutation is not responsible for subchronic neurotoxicity seen in dogs of non-collie breeds following macrocyclic lactone treatment for generalized demodicosis . Veterinary Dermatology 2009 ; 20 : 60 – 66 .
- Wiley Online Library |
- PubMed |
- Web of Science® Times Cited: 11
- 61 Bensignor E , Carlotti D . Moxidectin in the treatment of generalized demodicosis in dogs. A pilot study: 8 cases . In: Kwochka KW , Willemse T , Von Tscharner C , eds. Advances in Veterinary Dermatology . Oxford, Butterworth-Heinemann, 1998 ; 554 – 555 .
- 62 Burrows A . Evaluation of the clinical efficacy of two different doses of moxidectin in the treatment of generalized demodicosis in the dog . Annual Meeting of the Australian College of Veterinary Scientists, Goold Coast, Australia, 1997 .
- 63 Wagner R , Wendlberger U . Field efficacy of moxidectin in dogs and rabbits naturally infested with Sarcoptes spp., Demodex spp. and Psoroptes spp. mites . Veterinary Parasitology 2000 ; 93 : 149 – 158 .
- CrossRef |
- PubMed |
- CAS |
- Web of Science® Times Cited: 61
- 64 Heine J , Krieger K , Dumont P et al. Evaluation of the efficacy and safety of imidacloprid 10% plus moxidectin 2.5% spot-on in the treatment of generalized demodicosis in dogs: results of a European field study . Parasitological Research 2005 ; 97 ( Suppl 1 ): S89 – S96 .
- CrossRef
- 65 Fourie JJ , Delport PC , Fourie LJ et al. Comparative efficacy and safety of two treatment regimens with a topically applied combination of imidacloprid and moxidectin (Advocate®) against generalised demodicosis in dogs . Parasitological Research 2009 ; 105 ( Suppl 1 ): S115 – S124 .
- CrossRef |
- Web of Science® Times Cited: 8
- 66 Johnstone IP . Doramectin as a treatment for canine and feline demodicosis . Australian Veterinary Practitioner 2002 ; 32 : 98 – 103 .
- Web of Science® Times Cited: 17
- 67 Murayama N , Shibata K , Nagata M . Efficacy of weekly oral doramectin treatment in canine demodicosis . Veterinary Record 2010 ; 167 : 63 – 64 .
- CrossRef |
- PubMed |
- CAS |
- Web of Science® Times Cited: 6
- 68 Schnieder T , Kordes S , Epe C et al. Investigations into the prevention of neonatal Toxocara canis infections in puppies by application of doramectin to the bitch . Zentralblatt für Veterinärmedizin. Reihe B 1996 ; 43 : 35 – 43 .
- PubMed |
- CAS |
- Web of Science® Times Cited: 16
- 69 Schnieder T , Lechler M , Epe C et al. The efficacy of doramectin on arrested larvae of Ancylostoma caninum in early pregnancy of bitches . Zentralblatt für Veterinärmedizin. Reihe B 1996 ; 43 : 351 – 356 .
- PubMed |
- CAS |
- Web of Science® Times Cited: 5
- 70 Lavy E , Aroch I , Bark H et al. Evaluation of doramectin for the treatment of experimental canine spirocercosis . Veterinary Parasitology 2002 ; 109 : 65 – 73 .
- CrossRef |
- PubMed |
- CAS |
- Web of Science® Times Cited: 33
- 71 Yas-Natan E , Shamir M , Kleinbart S et al. Doramectin toxicity in a collie . Veterinary Record 2003 ; 153 : 718 – 720 .
- PubMed |
- CAS |
- Web of Science® Times Cited: 33
- 72 Geyer J , Klintzsch S , Meerkamp K et al. Detection of the nt230(del4) MDR1 mutation in White Swiss Shepherd dogs: case reports of doramectin toxicosis, breed predisposition, and microsatellite analysis . Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics 2007 ; 30 : 482 – 485 .
- Wiley Online Library |
- PubMed |
- CAS |
- Web of Science® Times Cited: 30
- 73 Miller WH Jr , Wellington JR Scott DW . Dermatologic disorders of Chinese Shar Peis: 58 cases (1981–1989) . Journal of the American Veterinary Medical Association 1992 ; 200 : 986 – 990 .
- PubMed |
- Web of Science® Times Cited: 12
- 74 Hamann F , Wedell H , Bauer J . Zur Demodikose des Hundes . Kleintierpraxis 1997 ; 42 : 745 – 754 .
- Web of Science® Times Cited: 5
- 75 Folz SD , Kratzer DD , Conklin RD et al. Chemotherapeutic treatment of naturally acquired generalized demodicosis . Veterinary Parasitology 1983 ; 13 : 85 – 93 .
- CrossRef |
- PubMed |
- CAS |
- Web of Science® Times Cited: 16
- 76 Anon. Dermatologists recommend neutering of canine patients with demodicosis . Journal of the American Veterinary Medical Association 1983 ; 182 : 1048 .
Related content
Articles related to the one you are viewing
Citing Literature
- Number of times cited : 19
- 1 Christine M. Zewe , Laura Altet , Andrea T. H. Lam , Lluís Ferrer , Afoxolaner and fluralaner treatment do not impact on cutaneous Demodex populations of healthy dogs, Veterinary Dermatology , 2017 , 28 , 5, 468 Wiley Online Library
- 2 Francesco Albanese , Canine and Feline Skin Cytology, 2017 , 77 CrossRef
- 3 Daniel G Bowden , Catherine A. Outerbridge , Marguerite B. Kissel , Jerome N. Baron , Stephen D. White , Canine demodicosis: a retrospective study of a veterinary hospital population in California, USA (2000-2016), Veterinary Dermatology , 2017 Wiley Online Library
- 4 Daniel E. Snyder , Scott Wiseman , Julian E. Liebenberg , Efficacy of lotilaner (Credelio™), a novel oral isoxazoline against naturally occurring mange mite infestations in dogs caused by Demodex spp., Parasites & Vectors , 2017 , 10 , 1 CrossRef
- 5 R.I. Rodriguez-Vivas , M.M. Ojeda-Chi , I. Trinidad-Martinez , A.A. Pérez de León , First documentation of ivermectin resistance in Rhipicephalus sanguineus sensu lato (Acari: Ixodidae), Veterinary Parasitology , 2017 , 233 , 9 CrossRef
- 6 Frédéric Beugnet , Lénaïg Halos , Diane Larsen , Christa de Vos , Efficacy of oral afoxolaner for the treatment of canine generalised demodicosis, Parasite , 2016 , 23 , 14 CrossRef
- 7 Robert H. Six , Csilla Becskei , Mark M. Mazaleski , Josephus J. Fourie , Sean P. Mahabir , Melanie R. Myers , Nathalie Slootmans , Efficacy of sarolaner, a novel oral isoxazoline, against two common mite infestations in dogs: Demodex spp. and Otodectes cynotis, Veterinary Parasitology , 2016 , 222 , 62 CrossRef
- 8 Rosario Cerundolo , Treatment of canine demodicosis, In Practice , 2016 , 38 , 10, 475 CrossRef
- 9 Ivan Ravera , Diana Ferreira , Laia Solano Gallego , Mar Bardagí , Lluís Ferrer , Serum detection of IgG antibodies against Demodex canis by western blot in healthy dogs and dogs with juvenile generalized demodicosis, Research in Veterinary Science , 2015 , 101 , 161 CrossRef
- 10 D.T. Pereira , L.J.M. Castro , V.B. Centenaro , A.S. Amaral , A. Krause , C. Schmidt , Skin impression with acetate tape in Demodex canis and Scarcoptes scabiei var. vulpes diagnosis, Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia , 2015 , 67 , 1, 49 CrossRef
- 11 John H.C. Hutt , I. Craig Prior , Michael A. Shipstone , Treatment of canine generalized demodicosis using weekly injections of doramectin: 232 cases in the USA (2002-2012), Veterinary Dermatology , 2015 , 26 , 5, 345 Wiley Online Library
- 12 Silvia Martínez-Subiela , Luis J. Bernal , Asta Tvarijonaviciute , Juan D. Garcia-Martinez , Fernando Tecles , Jose J. Cerón , Canine demodicosis: the relationship between response to treatment of generalised disease and markers for inflammation and oxidative status, Veterinary Dermatology , 2014 , 25 , 2, 72 Wiley Online Library
- 13 Tara E. Paterson , Richard E. Halliwell , Paul J. Fields , Marta Lanza Louw , Geoff Ball , Jakobus Louw , Rhonda Pinckney , Canine generalized demodicosis treated with varying doses of a 2.5% moxidectin+10% imidacloprid spot-on and oral ivermectin: Parasiticidal effects and long-term treatment outcomes, Veterinary Parasitology , 2014 , 205 , 3-4, 687 CrossRef
- 14 Clarissa P. Souza , Regina H.R. Ramadinha , Fabio B. Scott , Clinical and parasitological evaluation of pour-on fluazuron and ivermectin for treating canine demodicosis, Pesquisa Veterinária Brasileira , 2014 , 34 , 11, 1094 CrossRef
- 15 W. Chen , G. Plewig , Human demodicosis: revisit and a proposed classification, British Journal of Dermatology , 2014 , 170 , 6, 1219 Wiley Online Library
- 16 Lluis Ferrer , Ivan Ravera , Katja Silbermayr , Immunology and pathogenesis of canine demodicosis, Veterinary Dermatology , 2014 , 25 , 5, 427 Wiley Online Library
- 17 Shanker K. Singh , Umesh Dimri , The immuno-pathological conversions of canine demodicosis, Veterinary Parasitology , 2014 , 203 , 1-2, 1 CrossRef
- 18 Hui-Pi Huang , Yu-Hsin Lien , Treatment of canine generalized demodicosis associated with hyperadrenocorticism with spot-on moxidectin and imidacloprid, Acta Veterinaria Scandinavica , 2013 , 55 , 1, 40 CrossRef
- 19 Ekaterina Kuznetsova , Sonya Bettenay , Lyubov Nikolaeva , Monir Majzoub , Ralf Mueller , Influence of systemic antibiotics on the treatment of dogs with generalized demodicosis, Veterinary Parasitology , 2012 , 188 , 1-2, 148 CrossRef
Copyright © 1999 - 2018 John Wiley & Sons, Inc. All Rights Reserved
Demodikose hund
Dr. Stefanie Peters, Dr. Dr.h.c. Hans-Joachim Koch, Tierärztliche Klinik Birkenfeld
Die Demodikose des Hundes – Mehr als nur eine Erkrankung?
Der Lebensraum von Demodex canis, der wichtigsten Demodexmilbe des Hundes, sind vor allem die Haarfollikel (Haarbälge, deshalb auch die Bezeichnung „Haarbalgmilbe) sowie Talg- und apokrine Schweißdrüsen.
a) `gesunde` Haarbälge, rechts Talgdrüse
b) Demodex-Milben in den Haarbälgen
c) Haare sind im Bereich der Haarbälge zerstört, es bildet sich ein kleiner Propf (Komedonenbildung), bakterielle Überbesiedlung
d)Schwere, sekundäre bakterielle Infektion mit entzündlichen Veränderungen auch des die Haarbälge umgebenden Gewebes
Die Pathogenese der Erkrankung ist sehr komplex. Beim Menschen konnte mittlerweile eine Beziehung zwischen dem Vorliegen bzw. Nichtvorliegen bestimmter Leukozytenantigene (human leucoyte antigenes, sog. Histokompatibilitätsantigene) und einer Erkrankung an Demodikose nachgewiesen werden. Beim Hund fehlen bisher entsprechende Untersuchungsergebnisse.
Bei der hereditären (erblichen) generalisierten Demodikose des Hundes vermutet man seit einigen Jahren einen spezifischen, ausschließlich auf die Kontrolle der Demodexmilben beschränkten und nicht näher spezifizierten Defekt von T-Lymphozyten und erklärt damit auch die Prädisposition für diese Erkrankung bei bestimmten Rassen und das familiär gehäufte Auftreten .
Welche Hautveränderungen sind bei Demodikose durch Demodex canis typisch?
Durch eine übermäßige Vermehrung dieser Milbe in den Haarfollikeln (wo die Haare gebildet
werden), kommt es zu haarlosen Hautbezirken. Häufig weisen diese Hautbezirke eine Rötung der Haut (Erythem) und Schuppenbildung auf. Die betroffenen Stellen sind scharf begrenzt oder weisen diffuse Ränder auf. In vielen Fällen kommt es zu bakteriellen Sekundärinfektionen mit Pustel- und Krustenbildung sowie unterschiedlich starkem Juckreiz .
Die Diagnose einer Demodikose aufgrund von Demodex canis wird in aller Regel über eine mikroskopische Untersuchung von tiefen Hautgeschabseln gestellt. Diese Geschabsel werden mittels einer Skalpellklinge gewonnen, auf welche zum besseren Halt des zu gewinnenden Materials zunächst ein Tropfen Paraffinöl aufgetragen wird. Unmittelbar nach der Entnahme wird das Material auf Objektträger verbracht, mit Deckgläschen abgedeckt und bei 100facher Vergrößerung mikroskopisch untersucht. Bei manchen Rassen, z.B. dem Shar-Pei, und bei bestimmten Lokalisationen der Hautveränderungen, z.B. an den Pfoten, sowie bei entzündungsbedingt chronisch verdickter Haut kann der Milbennachweis durch Geschabsel trotz korrekter Entnahmetechnik falsch-negativ ausfallen. In solchen Fällen sollten bei Verdacht auf Demodikose Hautbiopsien (Gewebeproben) entnommen und auf Demodexmilben untersucht werden. Eine weitere nur im positiven Fall beweisende diagnostische Methode stellt die mikroskopische Untersuchung ausgezupfter Haare dar, an deren Wurzeln häufig Demodexmilben oder deren Eier nachweisbar
Im Gegensatz zur Sarkoptesräude ist der mikroskopische Nachweis einer einzelnen toten Demodexmilbe nicht ausreichend für die Diagnose „Demodikose. Hierfür sind mehrere lebende Milben, am besten mit Jugendstadien, erforderlich.
Bei allen Formen der Demodikose ist eine Behandlung mit Kortisonpräparaten wegen deren negativer Wirkung auf die Immunabwehr in jeder Anwendungsform kontraindiziert. Falls bereits eine Kortisonbehandlung erfolgte, müssen die Präparate umgehend abgesetzt werden. Sie dürfen bei Tieren mit hereditärer generalisierter Demodikose auch nach erfolgreicher Behandlung nur noch nach strenger Indikationsstellung sowie sorgfältiger Abwägung von Risiko und Nutzen angewandt werden.
Die Beseitigung der Demodexmilben erfolgt mit akariziden Mitteln, lokal vorzugsweise als Bäder oder Waschungen, und systemisch durch orale Verabreichung oder Spot on Präparate. Falls eine bakterielle Sekundärinfektion vorliegt, werden Antibiotika, welche sich als „hautwirksam erwiesen haben, in Tablettenform und antibakterielle Shampoos eingesetzt. Zur besseren örtlichen Behandlung sollte bei langhaarigen Hunden und tiefen, fistelnden Veränderungen das Haarkleid nach Möglichkeit geschoren werden. Eine Sedierung des Patienten erleichtert das Ausscheren, insbesondere bei schmerzhaften Hautveränderungen.
Therapie und Prognose sind bei den verschiedenen Formen der Demodikose sehr unterschiedlich. Damit ist eine korrekte Diagnose unerlässlich. Der Befund „Demodikose allein genügt nicht!
Unter Berücksichtigung von Ursachen, Lokalisation und dem klinischen Bild lässt sich eine klinisch-pathologische Einteilung in sieben verschiedene Demodikose-Erkrankungen vornehmen.
Hunde aller Rassen können an dieser Form der Demodikose erkranken. Die betroffenen Tiere sind meist im jugendlichen oder `pubertierenden` Alter. Sie zeigen einige wenige (normalerweise ein bis fünf) haararme bis haarlose Hautveränderungen, zunächst ohne Juckreiz, evtl. mit Rötung der Haut oder auch Schuppenbildung. Bei bakterieller Sekundärinfektion kann Pruritus (Juckreiz) dazu kommen. Die Stellen werden besonders häufig an Kopf und Hals, aber auch an Gliedmaßen und Rumpf beobachtet.
Die Erkrankung wird nicht selten rein zufällig entdeckt und leicht übersehen, vor allem bei langhaarigen Hunden.
Die lokalisierte Demodikose des jungen Hundes fГјhrt zu einer Spontanheilungsrate von Гјber 90%. Sie ist nach heutigem Wissensstand nicht erblich! Bei dieser Form der Demodikose ist kein Zuchtausschluss erforderlich.
Es wird empfohlen, auf ein akarizides Mittel zur Behandlung der Demodexmilben zu verzichten. Die Spontanheilung ohne Einsatz akarizider Mittel sichert die Feststellung, dass es sich nicht um eine generalisierte erbliche Form handelt.
Bakteriell infizierte Hautbezirke können dagegen mit einem antibakteriellen Mittel wie beispielsweise Benzoylperoxid-Gel oder Shampoo behandelt werden. Durch örtliche Anwendungen und die damit verbundene mechanische Reibung können solche Haare, welche Wurzelbereich bereits geschädigt sind und später sowieso ausgefallen wären, gleich verloren gehen und ein Fortschreiten der Erkrankung vortäuschen.
Falls gleichzeitig ein Befall mit Darmparasiten (v.a. Verwurmung) vorliegt und möglicherweise die Immunabwehr des Patienten beeinträchtigt, sollte dieser behandelt werden.
Regelmäßige Kontrollgeschabsel zur Überwachung des Krankheitsverlaufs werden alle 2-3 Wochen dringend empfohlen. Falls die Erkrankung in eine generalisierte Form übergehen sollte, kann so umgehend eine akarizide Therapie eingeleitet werden .
Lokalisiserte, spontane Demodikose (Demodex canis), hier haarlose Stelle unter dem Auge.
2. Lokalisierte, iatrogene Demodikose (Demodex canis)
Unabhängig vom Lebensalter und der Rasse kann eine lokalisierte Demodikose durch eine örtliche Immunsuppression ausgelöst werden, beispielsweise durch die Injektion eines Depot-Kortisonpräparates oder von Depot-Gestagenen (zur Läufigkeitsverhütung) unter die Haut oder durch die lokale Anwendung von Kortisonsalben oder -cremes.
Normalerweise ist nur eine einzelne Hautstelle betroffen, oft im Bereich der seitlichen Brustwand oder Flanke, wo eine subkutane Injektion erfolgte. Bei kurzhaarigen Hunden sind die Veränderungen offensichtlich, bei langhaarigen Hunden werden sie möglicherweise übersehen, da das gesunde Haar sie abdecken kann.
Wie bei der spontanen Form ist auch diese Erkrankung durch Veränderungen mit Haarverlust, Rötung der Haut, Pustel- und Krustenbildung und eventueller bakterieller Beteiligung mit oder ohne Juckreiz gekennzeichnet. Außerdem erscheint die Haut oft pergamentartig und durch einen Kortison-bedingten Abbau von Kollagen in der Cutis extrem dünn.
Die Veränderungen können hartnäckig sein. Sie können lange Zeit (bis über einem Jahr) bestehen bleiben, bevor sie nach Abklingen der (Depot-)wirkung des verursachenden Präparates dann meist ohne weitere Behandlung abheilen.
Zur Diagnose führen ein entsprechender Vorbericht, mikroskopische Untersuchungen tiefer Hautgeschabsel auf Demodexmilben und Untersuchungen auf Bakterien. Falls keine stärkere Entzündung festgestellt wird, kann einfach abgewartet werden, bis die Wirkung des Depot-Präparates abgeklungen ist und sich die Haut wieder normalisiert. Bei sekundärer bakterieller Infektion und zahlreichen lebenden Milben im Hautgeschabsel wird dagegen mit einem Akarizid und mit antibakteriellen Mitteln behandelt, normalerweise täglich über mehrere Wochen.
Da das Abheilen der Veränderung v.a. nach Anwendung von Depot-Präparaten viele Monate lang dauern kann, ziehen manche Besitzer die chirurgische Entfernung des subkutan liegenden Depotpräparates vor. Es stellt sich normalerweise als flaches Scheibchen im Unterhautgewebe dar und kann relativ einfach entfernt werden. Züchterische Maßnahmen sind bei dieser Demodikoseform natürlich ebenfalls nicht erforderlich.
Diese Form tritt beim jungen Hund, je nach Rasse bis etwa 1,5 oder 2 Jahre auf. Bei diesen Patienten ohne erworbene Immunsuppression geht man von dem bereits erwähnten erblichen spezifischen Immundefekt (autosomal-rezessiv?) und sekundärer Induktion einer unterschiedlich starken zellvermittelten Immunsuppression aus. Der Verlauf der Erkrankung hängt vom Schweregrad des Immundefekts und ob und in welchem Maß eine sekundäre bakterielle Infektion vorliegt und zu einer zusätzlichen sekundären Immunsuppression geführt hat.
Für die generalisierte, erbliche Demodikose gelten u.a. folgende Rassen als prädisponiert: Bobtail, Collie, Afghane, DSH, Cocker, Dobermann, Dalmatiner, Deutsche Dogge, Englische Bulldogge, Französische Bulldogge, Bullterrier, Boston-Terrier, Dackel, Chihuahua, Boxer, Mops, Shar-Pei, Beagle und Englischer Pointer.
Die Hautveränderungen äußern sich zunächst in fokaler oder diffuser Alopezie (Haarverlust) mit Schuppenbildung und Erythem (Rötung der Haut). Der Kopf, manchmal mit Veränderungen, die einer „Brillenbildung ähneln, und die Vorderbeine sind häufig als erstes betroffen. Eine Generalisierung erfolgt meist sehr rasch. Bakterielle Sekundärinfektionen treten regelmäßig auf und sind entweder oberflächlich mit Papeln, Pusteln, häufig mit Juckreiz oder tief mit Furunkeln, Zellulitis, Ödemen, Fistelbildung und Schmerz. Auch die Bildung von Komedonen („Mitessern) sowie Hyperkeratose (Verhornungsstörungen) werden beobachtet. Nicht selten kommt es zu einer generalisierten Lymphadenopathie (Schwellung aller Körperlymphknoten im Einzugsbereich der Haut) sowie schweren Allgemeinstörungen und Fieber. Durch Bakterientoxine und Entzündungsmediatoren werden auch andere Organe geschädigt. Durch die Sepsis (Blutvergiftung) kann es zum Tod des Patienten kommen.
Manche Hunde, v.a. Terrier-Rassen, zeigen dagegen nur multifokale hyperpigmentierte Hautbezirke bei ansonsten normal erscheinendem Haarkleid.
Die Behandlung der generalisierten Demodikose ist langwierig (mindestens 4-6 Monate) und bedarf einer besonders intensiven Zusammenarbeit zwischen Tierarzt und Tierhalter. Die meisten angeblich „resistenten Fälle sind in Wirklichkeit nicht konsequent mit ausreichender Fachkompetenz behandelt worden.
Moxidectin ist als spot-on-Formulierung (AdvocateВ®) gleichfalls zur Demodikosebehandlung zugelassen und wird nach Empfehlung des Herstellers alle 4 Wochen appliziert
Neben den zugelassenen Therapien gibt es verschiedene sehr gut wirksame Therapieprotokolle mit nicht für Kleintiere zugelassenen oder nicht für die Indikation Demodikose zugelassenen Wirkstoffen (meist makrozyklischen Laktone). Ihre Anwendung darf nur bei strenger Indikationsstellung unter tierärztlicher Kontrolle erfolgen.
Bei allen genannten Therapien gelten Kontrolluntersuchungen und –geschabsel im Abstand von 2-3 Wochen als unabdingbar für einen optimalen Erfolg.. Die Therapiedauer richtet sich nicht nach der äußerlich sichtbaren Besserung der Hautveränderungen, sondern der parasitologischen Kontrolle. Die Therapie sollte so lange durchgeführt werden, bis zumindest zweimal im Abstand von 2-3 Wochen die Geschabsel negativ sind. Bei der Verlaufskontrolle dienen die Gesamtzahl der Milben, der Anteil der noch lebenden Milben und der der Jugendformen als Beurteilungskriterien. Diese Kontrollgeschabsel sollten immer von denselben Hautbezirken genommen werden und, wenn möglich, immer eine Gliedmaße bzw. Pfote miterfassen.
Wie sehen die Kontrolluntersuchungen aus?
Alle 2-4 Wochen werden die Patienten sorgfältig untersucht und Hautgeschabsel entnommen (möglichst immer vom gleichen Untersucher und immer an den gleichen Hautbezirken!). Dabei werden die Gesamtzahl der Milben, das Verhältnis lebende:tote Milben und das Verhältnis erwachsene Milben:Jugendstadien insbesondere beurteilt.
Generalisierte Demodikose durch Demodex canis, vor und nach erfolgreicher Behandlung
Obwohl der Erbgang der hereditären generalisierten Demodikose nicht geklärt ist, sollten Hunde mit dieser Erkrankung sowie deren Elterntiere von der Zucht ausgeschlossen werden. Hündinnen sollen kastriert werden, zumal sich die Erkrankung unter dem Einfluss von Läufigkeit, Pseudogravidität, Gravidität und Laktation verschlimmern kann.
Je nach Form der Demodikose: Hervorragend bei den lokalisierten Formen, gut bis sehr vorsichtig bei den generalisierten Formen (je nach Primärerkrankung). Bei der hereditären generalisierten Demodikose können nach adäquater Therapie bis zu 2 von 3 Hunden geheilt werden.
Das Auftreten einer generalisierten Demodikose muss auch beim älteren Hund besonders ernst genommen werden. Hier kann die Erkrankung beispielsweise durch Verabreichung immunsuppressiv wirkender Medikamente (z. B. Glukokortikoide, Zytostatika) ausgelöst werden.
Spontan tritt sie bei bösartigen Tumorerkrankungen (Lymphosarkom, Hämangiosarkom, Mamma-Adenokarzinom), schweren Stoffwechselstörungen (Diabetes mellitus oder Cushing-Erkrankung) und einigen Lebererkrankungen auf.
In Einzelfällen kann die Demodikose äußerlicher Anzeichen derartiger Erkrankungen bis zu 12 Monaten vorauseilen, so dass entsprechende engmaschige Untersuchungen des Patienten anzuraten sind.
Bei allen entzündlichen Hautveränderungen im Pfotenbereich (sog. Pododermatitis) muss differentialdiagnostisch eine Erkrankung durch Demodexmilben (Pododemodikose durch Demodex canis) in Betracht gezogen und entsprechende mikroskopische Untersuchungen durchgeführt. werden. Häufig sind die Pfoten ödematös geschwollen und sehr schmerzhaft, dazu kommen tiefe bakterielle Infektionen und wechselnde Lahmheiten. Manchmal äußert sich die Erkrankung einfach in „Füße-Lecken aufgrund des Juckreizes. Prädisponiert sind Neufundländer, Bernhardiner, Deutsche Doggen, Bobtails und andere große Rassen sowie Westhighland White-Terrier.
Die Pododemodikose (Demodikose der Pfoten) kann entweder als Relikt (Überbleibsel) einer früheren generalisierten Demodikose oder als eigenständiges Problem ohne Veränderungen am restlichen Körper auftreten.
Die Behandlung erfolgt entweder lokal oder systemisch wie bei der generalisierten Demodikose geschildert.
Pododemodikose (Demodex canis)
6. Demodikose durch Demodex cornei
Sie ist kürzer und breiter als Demodex canis, lebt deutlich oberflächlicher und wird manchmal zusammen mit Demodex canis nachgewiesen. Eine Demodikose durch Demodex cornei geht mit Rötungen der Haut, Schuppenbildung und deutlichem Juckreiz einher. Für ihren Nachweis kann auch ein sog. Tesafilm-Abklatsch-Test herangezogen werden .
Bild links: Veränderungen der Qualität des Haarkleids und Juckreiz durch Demodex cornei.
Bild rechts: Generalisierte Demodikose (Demodex canis)
Räude bei Hunden (Eckzahn Krätze)

Sarcoptesräude (Sarcoptes scabiei) leicht zwischen Hosts übertragen. Auch bekannt als Eckzahn Krätze wird Sarcoptesräude von Milben, die ovale, hell und mikroskopische verursacht werden.
Alle Hunde in der Regel von ihren Müttern erhoben besitzen Demodikose Milben (Demodex canis), die von der Mutter auf pup über Kuscheln während der ersten Tage des Lebens übertragen werden. Die meisten Hunde leben in Harmonie mit ihrer Milben, keine Konsequenzen nie leiden.
Es gibt drei Arten von Demodikose, die Eckzähne beeinflussen. Lokalisierte Fällen auftreten, wenn diese Milben vermehren sich in ein oder zwei kleine, geschlossenen Räumen. Dies führt dazu, isolierte schuppig kahle Stellen-Regel auf den Hund das Gesicht schaffTupfen Aussehen. Lokalisierten Demodikose wird als eine häufige Erkrankung der Welpenzeit und ca. 90% der Fälle zu lösen ohne Behandlung jeglicher Art.
Generalisierte Demodikose im Gegensatz dazu wirkt sich größere Bereiche der Haut oder ein Hunde ganzen Körper. Sekundäre bakterielle Infektionen machen dies zu einem sehr juckende und oft stinkenden Hautkrankheit. Diese Form der Räude könnte auch ein Zeichen von einem geschwächten Immunsystem, erbliche Problem, endokrine Probleme oder andere zugrunde liegenden gesundheitlichen Problem. Die Behandlung richtet sich nach dem Alter, in dem der Hund die Krankheit entwickelt.
Einer der resistenten Formen von Räude wird demodectic pododermatitis zum Fuß beschränkt, und begleitet von bakteriellen Infektionen. Tief Biopsien sind oft erforderlich, diese Milben zu lokalisieren und eine richtige Diagnose zu stellen.
Aktuelle Denken ist, dass Demodex-Milben können von einem Hund zu einem anderen übertragen werden, aber solange der Hund gesund ist, einfach nur die Milben auf natürliche Milbenpopulation des Hundes und keine Hautkrankheit Ergebnisse hinzuzufügen. Isolation von Hunden mit sogar den schwersten Fällen ist noch zu spüren sein unnötigen-wenn auch in seltenen Fällen ist Ansteckung möglich. Zwar gibt es noch verschiedene Theorien über Hund zu Hund Übertragung von Demodex-Milben, wird akzeptiert, dass Milben können nicht auf den Menschen oder auf Katzen übertragen werden.
Die Symptome der Räude davon abhängen, welche Art von Milben vorhanden ist. Demodikose neigt dazu, Haarausfall, kahle Stellen, Schorfbildung und wunde Stellen verursachen. Sekundäre bakterielle Infektionen können Demodikose eine juckende und unbequem Krankheit zu machen.
Sarcoptesräude tendenziell starken Juckreiz verursachen. Es kann in Unruhe und hektische Kratzen, Symptome, die in der Regel erscheinen eine Woche nach Belastung führen. Es kann auch in Haarausfall, gerötete Haut, Körper Wunden und Krusten führen. Die am häufigsten betroffenen Gebiete sind ein Hund die Ohren, Ellbogen, Gesicht und Beine, aber es kann schnell auf den gesamten Körper aus.
Wenn den Menschen übertragen, verursacht Sarcoptesräude einen Ausschlag von roten Beulen, ähnlich wie Mückenstiche. Der Mensch kann nicht Demodikose von Hunden bekommen.
Nehmen Sie Ihren Hund zu einem Tierarzt, der eine körperliche Untersuchung durchführen wird, Hautgeschabsel analysieren und versuchen, die Anwesenheit von Räude Milben mit einem Mikroskop zu bestätigen. Es kann schwierig sein, Räudemilben zu identifizieren, wenn sie tief in die Haut ein Hund begraben, so dass Ihr Tierarzt kann auf klinische Anzeichen verlassen oder die Geschichte Ihres Haustieres, um eine endgültige Diagnose zu stellen.
- Welpen und Hunde weniger als 18 Monate alt sind besonders anfällig localizeddemodectic Räude zu entwickeln, die auf eigene löscht häufig auf.
- Generalisierte Demodikose, desto gravierender, durchdringenden Art können bei Hunden erblich bedingt sein. Bobtails und Shar Peis sind anfällig für eine schwere Form der Demodikose, die die Füße. Ältere Hunde, die eine Grunderkrankung haben auch anfälliger sein.
Je nach Art der Räude und die Rasse Ihres Hundes, können Medikamente oral oder über Shampoo und dip gegeben oder topisch angewendet, durch Injektion werden.
Der erste Schritt bei der Behandlung von Sarcoptesräude wird Isolieren Sie Ihren Hund, um den Zustand ein Übergreifen auf andere Haustiere und Menschen zu verhindern. Ihr Tierarzt kann antiparasitäre Medikamente sowie Medikamente verschreiben, um das Jucken, Entzündungen und sekundäre Infektionen der Haut zu erleichtern. Resultate werden in der Regel nach einem Monat der Behandlung.
Bitte beachten Sie, können viele Hautbehandlungen für Hunde giftig sein und nicht häufig wiederholt werden sollte, so überprüfen Sie mit Ihrem Tierarzt, bevor sie eine Behandlungsprogramm für Räude beginnen.
Jüngere Hunde erholen oft voll von Räude, aber erwachsene Hunde erfordern oft eine Langzeittherapie zur Bekämpfung der Krankheit. Hunde mit Demodikose sollte nicht gezüchtet werden, da dieser Zustand wird angenommen, erblich zu sein.
Die Behandlung, egal, welche Option gewählt wird, sollte von Haut einhergehen kratzt alle zwei Wochen. Nach zwei aufeinanderfolgenden Kratzer negativ sind, ist das Medikament abgesetzt, sondern eine endgültige Kratzen, einen Monat nach der Behandlung durchgeführt, um sicherzustellen, dass es keine Wiederholung werden.
- Wenn Ihr Hund hat mit Sarcoptesräude diagnostiziert wurde, werden Sie gründlich zu reinigen benötigen oder sein Bettzeug und Kragen zu ersetzen und zu behandeln, alle Tiere in Kontakt.
- Wenn Sie eines Nachbars Hund Infektion vermutet, Ihren Haustieren fernhalten, die Krankheit in Schach zu halten.
- Bringen Sie Ihren Hund regelmäßig zum Tierarzt für nochmalige Überprüfung der Haut kratzt empfohlen, die Milben ausgerottet worden gewährleisten haben.
Boerboel
The greatest WordPress.com site in all the land!
Gesundheit
Der Boerboel wird als eine gesunde Rasse angesehen. Das hat damit zu tun, dass die Rasse Leistungsgezüchtet wurde und immernoch wird (also nicht nach Farbe oder Ausstellungsmeriten selektiert wird). Dadurch konnten nur starke und gesunde Individien ihre Gene weiterführen. Wie jedoch in allen Rassen, so gibt es mehr oder weniger rassetypische Krankheiten, über die man sich bewusst sein sollte. Auch haben nicht alle Züchter den arbeitenden Boerboel bei der Selektion ihrer Zuchttiere vor Augen. Als Welpenkäufer solltest du dich mit nicht weniger als gesunden und untersuchten Elterntieren zufrieden geben, um mit grösster Wahrscheinlichkeit einen gesunden Welpen zu bekommen, der dir lange viel Freude bereitet. Auf dieser Seite haben wir ein paar mehr oder weniger gewöhnliche Krankheiten zusammengestellt, die in dieser Rasse vorkommen.
Hüftdysplasie bedeutet, dass das Hüftgelenk falsch entwickelt ist, also die Gelenkschale zu flach ist. Dies hat Knorpelschäden und Knochenablagerungen (Artrose) zu Folge. Das Gelenk wird unstabiel und das kann zu Lahmheit und Schmerzen führen, oftmals werden die Symptome schlimmer im Alter. In schlimmen Fällen ist das Gelenk vollkommen deformiert und in sehr schlimmen Fällen ist das Einschläfern des Hundes der einzigen Ausweg, egal wie alt der Hund ist. Der Status des Hüftgelenkes wird durch Röntgen beim Tierarzt festgestellt. Die Röntgenbilder werden an den Züchterverein zur Auswertung geschickt.
Hüftdysplasie ist ein Defekt, der sowohl erbliche als auch umweltbedingte Ursachen hat. Das bedeutet, dass sowohl die Zucht aber auch wie der Welpe aufwächst die Entwicklung des Hüftgelenkes beeinflussen. Der Defekt wird polygen vererbt, d.h. dass viele Gene zusammen wirken um eine Eigenschaft in einem hohen oder niedrigen Grad zu vererben. Jedes Gen für sich beeinflusst eine Eigenschaft nur wenig, eine Kombination jedoch kann einen Defekt hervorrufen. Das bedeutet deswegen leider auch, dass es in seltenen Fällen dazu kommen kann, dass ein ganzer Wurf von einem Defekt betroffen ist, obwohl dieser in zurückliegenden Generationen nicht auftritt. Das Risiko für einen defekten Welpen erhöht sich jedoch deutlich, wenn einer oder beide Eltern Dysplasie haben. Es ist sehr wichtig, dass du deinen Hund mit ca 18 Monaten röntgst und deinen Züchter über das Resultat benachichtigst. Hunde, die defekte Welpen hinterlassen sollten aus dem Zuchtprogramm ausgeschlossen werden und ein Züchter muss deswegen den Hüftstatus für den ganzen Wurf wissen, um seine Zucht auswerten zu können. Ausser dem normalen HD-röntgen sollte man ausserdem einen sogenannten PennHip-röntgen machen, der schon gemacht werden kann wenn der Welpe erst 16 Wochen alt ist. Wir empfehlen jedoch den HD-röntgen und den PennHip-röntgen gleichzeitig zu machen. Beim PennHip-röntgen misst man, wie locker das Hüftgelenk ist. Somit kann ermittelt werden, wie hoch das Risiko ist, dass der Hund ist später im Leben Artrose entwickelt. Diese Röntgenbilder werden an ein Institut in den USA zur Auswertung geschickt. Nur vom Institut zertifizierte Tierärzte dürfen diese Röntgenuntersuchung machen. [Hier] findest du Tierärzte in deiner Nähe, die PennHip-röntgen ausführen.
Der Umweltfaktor, also der nicht erbliche Faktor der den Defekt verursacht, ist die Art und Weise wie der Welpe die ersten 1,5 Jahre aufwächst. Man muss so einiges beachten, um das Risiko für Hüftdysplasie zu minimieren. Der Welpe sollte ein Futter bekommen, das an Welpen und später an Junghunde angepasst ist. Für Boerboel sollte das Futter ausserdem für grosse Rassen zusammengesetzt sein. Wenn du eigenes Futter machst, solltest du dich genau darüber informieren was ein wachsender Hund an Vitaminen und Mineralien braucht – das unterscheidet sich nämlich vom Bedarf erwachsene Hunde haben. Auch das Eiweiss-Fettverhälltnis im Futter ist wichtig. Wir empfehlen extra Glukosamin und Vitamin C unter das Futter zu mischen. Man sollte jedoch nicht vergessen, dass es zur Zeit keine Forschung gibt, die die positive Beeinflussung dieser Nahrungsergänzungsmittel auf die Entwicklung der Hüftgelenke untersucht. Jedoch wurden positive Erfahrungen von Züchtern und Hundebesitzern berichtet. Während der Welpe aufwächst ist es extra wichtig, dass er schlank bleibt. Schon ein bischen Übergewicht erhöht das Risiko für Dysplasie. Auch die Art und Menge von Bewegung beeinflusst die Entwicklung des Gelenkes. Bis zu einem Alter von frühestens 18 Monaten sollte all Stärke- und Ausdauertraining vermieden werden. Das bedeutet, möchtest du mit deinem Hund Fahrrad fahren, mit ihm Weight Pull trainieren, Taschen tragen lassen, etc so ist es sehr wichtig diese Art von Training nicht zu früh anzufangen. Auch das Spiel mit ruppigen Hunden sowie Bällchen/Stöckchen holen (plötliches und kräftiges Einbremsen) sollten vermieden werden. Das Bedeutet jedoch absolut nicht, dass man den Welpen daran hindern sollte sich natürlich zu bewegen. Alle Alltagssituationen, die der Welpe später meistern soll, sollte er schon als Welpe üben, z.B. (einige) Treppen hoch und runtergehen, an der Leine und ohne Leine gehen, spielen, ins Auto hüpfen und wieder raus, etc. Es ist wichtig dass der Welpe seine Gelenke, Muskeln und Knochen während seiner gesamten Wachstumsphase für normale physische Aktiviteten in seinem eigenen Takt und ohne Zwang benutzen kann. Denk daran, dass der Boerboel eine schwere Rasse ist. Lange oder monotome Belastungen verschleissen Gelenke mehr als bei leichten Rassen. Verschleissschäden oder Dysplasie sind oftmals mit Schmerzen verbunden!
Kaufe nur einen Welpen nach freigeröntgten Eltern. Am Besten ist es wenn sowohl ein HD-röntgen als auch en PennHip-röntgen gemacht wurden. Die Hüftwerte für den PennHip sollten nicht 0,5 übersteigen, der HD-status sollte A oder B alt. 0 oder 1 sein. Verlange, die Untersuchungsresultate zu sehen. Kaufe keine Welpen von Züchtern, die sich weigern die Unterlagen zu zeigen. Sei sehr genau mit der Ernährung und Bewegung des Welpen.
Ellenbogendysplasie bedeutet, dass das Ellenbogengelenk falsch entwickelt ist. Dieser Defekt entwickelt sich immer zur Arthrose. Die Ursachen für diesen Defekt sind entweder Erblich und/oder beruhen auf Umwelteinflüsse, die im Abschnitt “Hüftdysplasie” beschrieben sind. Ellebogendysplasie kan auch von den Krankheiten fragmentierte processus coronoideus (FPC), osteochondrosis dissecans (OD) und/oder ununited processus anconeus (UPC) hervorgerufen werden. Der Status des Ellenbogengelenkes wird durch Röntgen beim Tierarzt festgestellt. Die Röntgenbilder werden an den Züchterverein zur Auswertung geschickt. röntgen gleichzeitig zu machen.
Kaufe nur einen Welpen nach freigeröntgten Eltern. ED-status soll 0 sein. Verlange, die Untersuchungsresultate zu sehen. Kaufe keine Welpen von Züchtern, die sich weigern die Unterlagen zu zeigen. Sei sehr genau mit der Ernährung und Bewegung des Welpen.
Entropion/Ectropion bedeutet, dass das untere Augenlied sich entweder nach innen rollt und am Augapfel schabt oder sich nach aussen rollt und einen höheren Tränenfluss verursacht. Dieser Defekt wird als erblich angesehen und betroffene Individien sollten aus dem Zuchtprogramm ausgeschlossen werden. benachritige deinen Züchter, falls dein Welpe mit Entropion/Ectropion diagnostiziert wurde.
Kaufe nur einen Welpen nach freigetesteten Eltern. Verlange, die Untersuchungsresultate zu sehen. Kaufe keine Welpen von Züchtern, die sich weigern die Unterlagen zu zeigen.
Vaginal Hyperplasi innebär att vävnaden i vaginan reagerar för starkt på östrogenet under tikens löp. Vaginan sväller upp och kan komma fram genom vulvan, vilket ser ut som en tunga. Av den anledningen brukar vaginal hyperplasi även betecknas som slidframfall hos vissa uppfödare. Vaginal hyperplasia anses vara ärftligt och drabbade hundar bör plockas ur avel.
Köp enbart en valp efter en fritestad tik. Kräv att få se veterinärintyg på undersökningen.
Demodex bezeichnet die Haarbalgmilbe, die die Krankheit Demodikose verursacht. Etwas schlampig wird die Krankheit an sich manchmal als Demodex bezeichnet. Die Haarbalgmilbe lebt in den Haarbälgen aller Hunde und werden erst zu einemProblem wenn ein Hund ein geschwächtes Immunsysthem hat und so nicht die Milbe “in Schach halten” kann. In diesen Fällen vermehren sich die Milben ungehindert. Demodikose wird in zwei Formen unterteilt, die lokale Form und die generalisierte Form. Die erste Form kommt meist bei Junghunden vor, die jünger als ein Jahr alt sind und verschwindet normalerweise wieder. Sie macht sich durch kahle Stellen an den Vorderbeinen und dem Gesicht bemerkbar und meistens hat der betroffene Hund keinen Juckreiz. Die andere Form kann sowohl junge als auch ältere Hunde befallen und deckt dann normalerweise den Körper grossflächiger.
Die Sympthome sind wie schon genannt kahle Flecken im Pelz und Juckreiz, manchmal sehr schwerer solcher. Die Krankheit kann so schwer und qualvoll für den Hund werden, dass dieser eingeschläfert werden muss. Das war früher sehr gewöhnlich, heute können ungefähr 90% aler Hunde wieder Symptomfrei werden. Trotzdem ist Demodikose eine der am schwersten zu behandelnden Hautkrankheiten bei Hunden und die Sympthome sind oftmals sehr qualvoll für den betroffenen Hund. Demodikose kann weder Menschen noch gesunde Tiere anstecken. Ein Hund kann für gesund erklärt werden, wenn 2 negative Tests mit einem Intervall von 4 Wochen durchgeführt wurden.
Demodikose wird mittels einer Schabeprobe, die von einem Tierarzt entnommen wird, ermittelt. Die Krankheit ist erblich und wird rezessiv vererbt. Beide Elterntiere müssen also wenigstens Träger der Krankheit sein, damit ein oder mehrere Welpen in einem Wurf an der Krankheit erkranken. Hunde, die an Demodikose erkrankt sind oder kranke Würfe hinterassen haben sollten aus dem Zuchtprogramm ausgeschlossen werden. Dies gilt auch für die Geschister erkrankter Hunde.
Wenn du dir die Elterntiere eines Wurfes anguckst, solltest du eventuelle Sympthome beachten. Kaufe keinen Welpen, wenn du weisst oder vermutest, dass eines oder beide Elterntiere Demodikose haben.
Olika allergier kan förekomma inom rasen, men är dock mer sällsynt. Detta kan vara allt från foderallergier (oftast mot spannmål eller nötkött) till allergier mot olika kvalster eller pollen. Allergier visar sig genom många olika symptom som t ex klåda, kala ställen i pälsen, hudsvamp, magproblem såsom diarré och kräkningar, etc. Symptomen visar sig vanligtvis från ett års ålder, men kan dröja tills dess att hunden har uppnått en högre ålder.
SKK och veterinärer rekommenderar att utesluta individer från avel som själva har allergier, har syskon med allergier eller har lämnat valpar med allergier. Det anses att allergier är ärftliga, men även två friska föräldrar kan lämna allergiska valpar efter sig.
Allergier utreds via blodprov samt hudtester hos veterinären. Det är inte vanligt att man testar Boerboel för allergier inför avel utan tester utförs då misstankar om en allergi uppstått. Det är alltid mycket viktigt att du kontaktar din uppfödare om din valp har en diagnostiserad allergi. En seriös uppfödare tar då föräldrardjuren och eventuella avkommor ur avel samt underrättar de andra valpköparna.
När du tittar på föräldradjuren var uppmärksam på eventuella symptom. Avstå från ett valpköp efter föräldrar där du vet om eller misstänker allergi.
Ibland kan patellan, dvs knäskålen, vara fel utvecklad och den kan då förflyttas antingen inåt eller utåt. Patellan undersöks av veterinär och en sådan undersökning bör göras innan avel. Hundar med fel utvecklad patella bör uteslutas ur avelsprogrammet. Patellaluxation kan ha olika orsaker och ibland kan hunden vara symptomfri. I gravare fall kan hunden börja halta. Hur patellaluxation ärvs ner är inte fastställt än. Patellaluxation förekommer dock oftast bland små raser.
Osteochondros är en ärftlig men icke medfödd tillväxtrubbning som uppstår när valpen växer som fortast, dvs mellan 4 – 6 månaders ålder. Defekten förvärras genom felaktig utfodring eller motion (se även höftledsdysplasi). Underrätta alltid din uppfödare om du misstänker eller har fått diagnosen osteochondros på din valp!
Molossers i allmänhet anses ha lätt för att utveckla hjärtfel. Hjärtfel är sällsynta inom Boerboel, men en seriös uppfödare bör undersöka hjärtstatus på sina avelsdjur innan avel, då hjärtfel anses vara ärftliga. Inom Boerboeln hör förstorad hjärtmuskel till de vanligare hjärtfelen.
Ögonsjukdomar (bortsett från Entropion/Ectropion) förekommer mer sällan inom rasen. Trots det ögonlyser en seriös uppfödare sina avelsdjur enligt gällande rekommendationer, dvs en gång årligen. Mer om olika ögonsjukdomar finns att läsa [här].
Kroksvans kan förekomma, men brukar inte medföra problem för hunden, förutom estetiska. Hundar med kroksvans skall ändå uteslutas ur avelsprogrammet, då kroksvans kan sätta sig i ryggraden hos avkommorna och den drabbade individen måste då avlivas.
Cancer kan förekomma, är dock sällsynt och sjukdomen uppstår i så fall oftast i hög ålder.
Комментариев нет:
Отправить комментарий